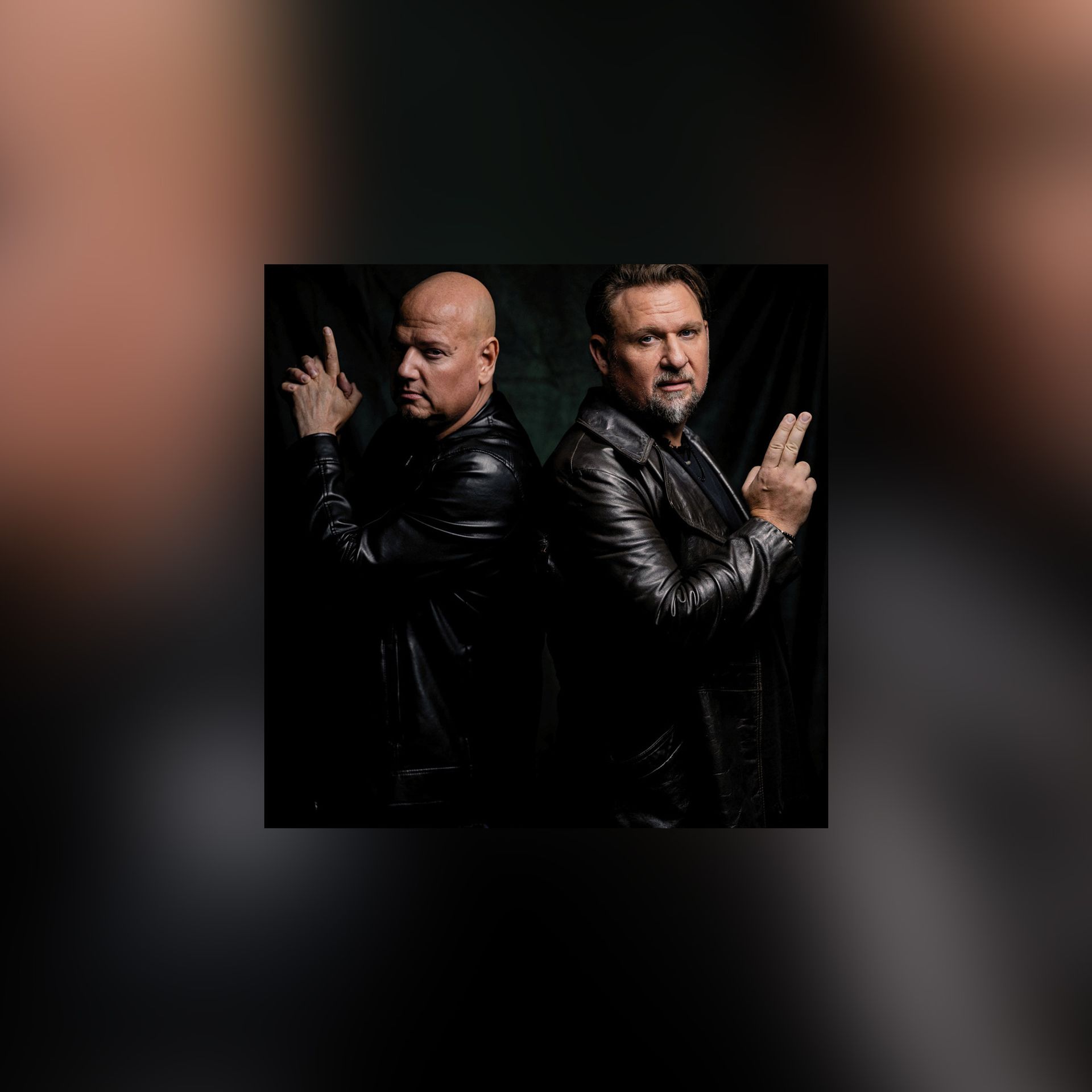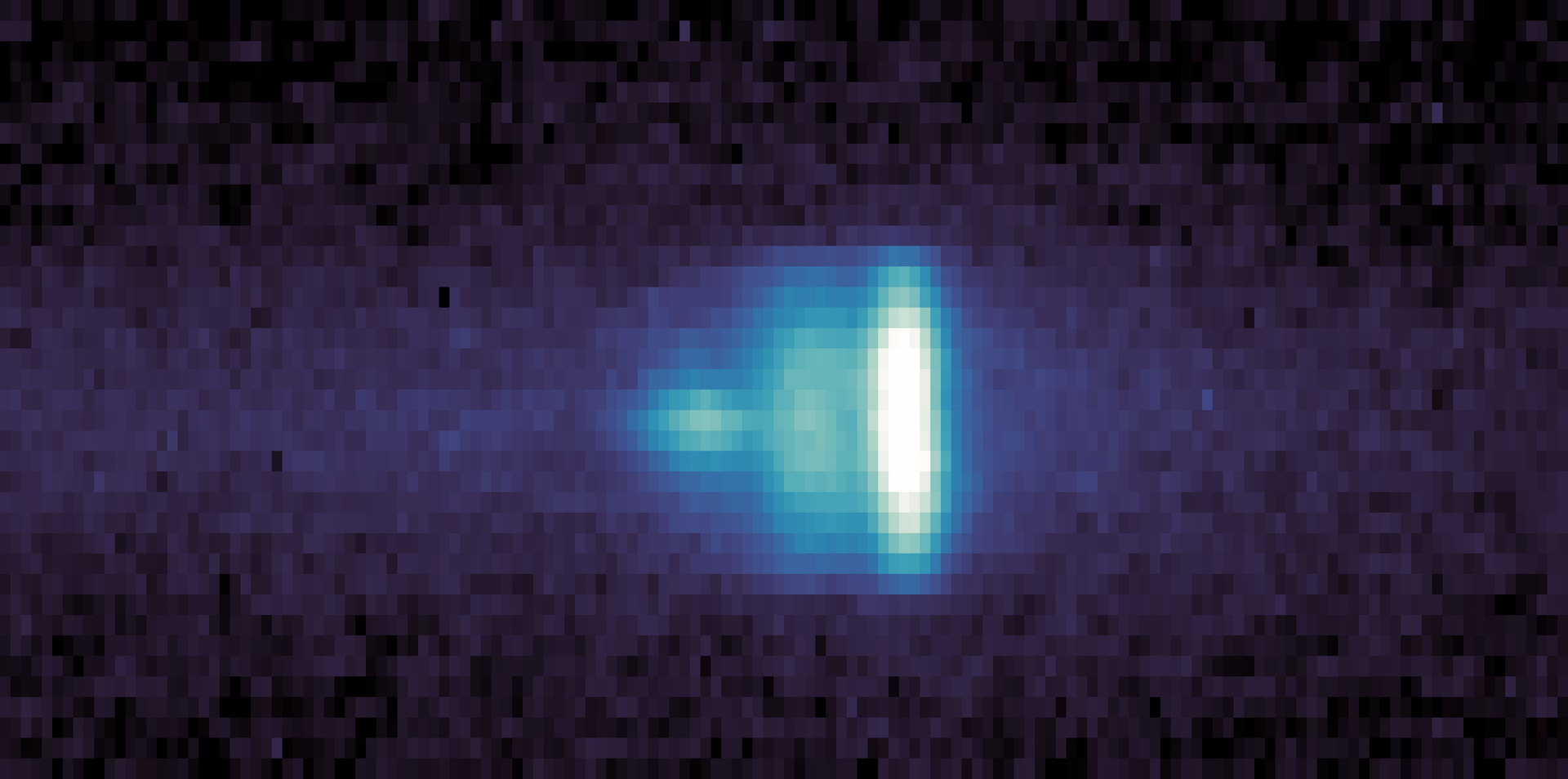DARK ODDITIES #13
Disclaimer: Die hier gezeigten Beiträge enthalten zum Teil erschreckendes, verstörendes Material, sowie schnelle Lichtwechsel die möglicherweise epileptische Anfälle auslösen können.

Prolog
Endlich wieder Halloween und wir melden uns zurück mit der zweiten Staffel unserer Reihe Dark Oddities. Wir haben die Zeit genutzt erneut in die tiefen Katakomben des Internets hinab zu steigen, uns vorbei an alten WorldWideWeben entlang den finsteren Regalen ihrer schon leicht modernden Archive zu schleichen und neues, erschreckendes Material zusammen zu tragen, das wir euch ab heute wieder präsentieren möchten. Denn auch im Dunklem und Verstörendem findet sich Inspiration!
The Caretaker – Everywhere At The End Of Time
Wie schon im allerersten Teil von Dark Oddities, wollen wir auch diesmal mit einem Musikalbum beginnen. Genau genommen handelt es sich bei diesem um eines der verstörendsten Alben der Musikgeschichte. James Leyland Kirby ist ein alter Hase des Ambient und der experimentellen Elektronik, der in den 1990ern begann sich ernsthaft mit geistigen Erkrankungen zu beschäftigen. Der Initialfunke seines 1999 begonnenen Projekts The Caretaker war eine Ballroom-Szene in Stanley Kubrick's Horrorfilmklassiker The Shining gewesen, in dem der zunehmende Wahnsinn des von Jack Nicholson verkörperten "Caretakers" ebenso eine Rolle spielt wie das Festhalten an schönen Erinnerungen: Nostalgie, Romantik und Melancholie.
Zwischen 2016–2019 veröffentlichte The Caretaker sein letztes und größtes Werk, das auf mehrere Platten aufgeteilte Album Everywhere At The End Of Time. Was es so verstörend macht? Es stellt eine entsetzlich nachvollziehbare Interpretation der Alzheimer Erkrankung dar. Vom anfänglichen Festhalten an schöne Erinnerungen über das zunehmende Vergessen, den unaufhaltsamen Verfall des Bewusstseins, bis hin zum völligen Verlust jeglichen klaren Gedankens. Ein langsam vor sich hin siechender Alptraum, der jeden halbwegs empathischen Menschen mit einem gebrochenem Herzen zurücklässt.
Security1275
Obwohl ich mich seit nunmehr einem Jahr mit dunklen und verstörenden Inhalten auseinandersetze, habe ich doch keine Skrupel davor in meiner Funktion als Nachtwächter meine allabendlichen Runden zu drehen. Es ist ja nicht so, als müsste ich mich vor Gespenstern fürchten! Oder? Nun, will man meinem Kollegen Josh glauben, sollte man zumindest den Colonial Park Friedhof in Savannah, Georgia meiden. Seit Mitte 2019 nimmt er TikTok-User auf seinen Rundgängen mit, wo allerhand mysteriöses Zeug passiert. Erlaubt sich hier jemand einen Spaß mit uns oder ist das was wir sehen echt? Wie auch immer, es ist spannend zuzusehen und selbst unser alter Freund Nexpo hat schon darüber berichtet...
Die Backrooms
Wir haben in der Vergangenheit ja bereits über das Themengebiet Glitch gesprochen, über auffällige Fehler in einem (digitalen) System. In einer Simulation, wie etwa einem Computerspiel, äußern sich Glitches auch mal in Form sonderbarer Ereignisse wie einfrierende, verschwindende oder unplanmäßigen physikalischen Kräften ausgesetzte NPCs. Auch in der wirklichen Welt finden sich hin und wieder Ereignisse die den Anschein erwecken "Glitches" zu sein. Hinweise das mit der von uns wahrgenommenen Realität etwas nicht stimmt. Aus dieser Idee gingen einige Urban Legends hervor, darunter die Folgende: Wer das Pech hat von einem Moment auf dem Nächsten aus der Realität zu fallen, landet in einem Labyrinth aus leeren Räumen und Korridoren, genannt die "Backrooms". Ein Ort jenseits von Zeit und Raum, in dem man sich endlos verlaufen kann und gelegentlich vor grässlichen Monstern verfolgt wird.
Die Ursprünge der Legende gehen auf ein Foto zurück das 2018 von einem anonymen 4chan-User in einem Thread über "Cursed Images" gepostet wurde. Dieses wurde 2019 um folgendes Narrativ ergänzt und repostet:
"If you're not careful and you noclip out of reality in the wrong areas, you'll end up in the Backrooms, where it's nothing but the stink of old moist carpet, the madness of mono-yellow, the endless background noise of fluorescent lights at maximum hum-buzz, and approximately six hundred million square miles of randomly segmented empty rooms to be trapped in..."
Der Repost wiederum bildete die Grundlage für eine Creepypasta von Redditor yourdndguy, die sich in Windeseile über das Internet verbreitete und somit die Legende einem breiteren Publikum zugänglich machte. Also... nichts als Schall und Rauch? Das Hirngespinst einiger leicht zu beeindruckender Nerds mit Freude an Horrorgeschichten? Wenn dem so ist, warum beunruhigt uns der Anblick dieser Räume so? Welche tiefliegenden Instinkte werden von ihnen angesprochen? Nick Crowley erzählt uns Näheres:
Der Enfield Poltergeist
Zwischen 1977 - 79 fanden im Haus der Familie Hodgson in Brimsdown, Enfield, London eine Reihe erschreckender Ereignisse statt: Rückende Möbel, seltsames Klopfen, Stimmen aus dem Nichts, um nur einige davon zu nennen. Zahlreiche Augenzeugen waren zugegen, darunter Vertreter der Presse und der Polizei. Maurice Grosse und Guy Lyon Playfair von der Society for Psychical Research, einer Non-Profit-Organisation die sich der Erforschung paranormaler Aktivitäten verschrieben hat, nahmen sich der Sache an und waren am Ende überzeugt einen waschechten Poltergeist entdeckt zu haben. Ihnen schlossen sich 1978 die amerikanischen Dämonologen Ed und Lorrain Warren an.
Leider entpuppten sich einige der Geschehnisse als raffinierte Streiche der beiden Töchter Janet (13) und Margaret (11), die sich einen Spaß daraus machten die Wissenschaftler und sensationshungrigen Journalisten in die Irre zu führen. Grosse, Playfair und die Warrens waren dennoch überzeugt, es könnte zumindest teilweise etwas an der Sache dran sein. was ihnen in der Fachwelt viel Skepsis, Spott und Hohn einbrachte. Doch auch wenn es sich bei dem Enfield Poltergeist nur um einen Schwindel gehandelt hat, die ruchlose Hinterlist mit der Janet und Margaret Hodgson ihr Umfeld über so lange Zeit in Angst und Schrecken versetzten und den Ruf etlicher Leute geschädigt hatten, ist in sich bereits furchteinflößend. Janet soll sich dabei sogar als talentierte Bauchrednerin entpuppt haben.
Der Enfield Poltergeist inspirierte Jahre später die berüchtigte verbotene TV-Sendung Ghostwatch (näheres dazu in Dark Oddities # 2). Der Fall selbst bildete die Vorlage für den Horrorfilm The Conjuring 2 (2016).
#FEEDBACK