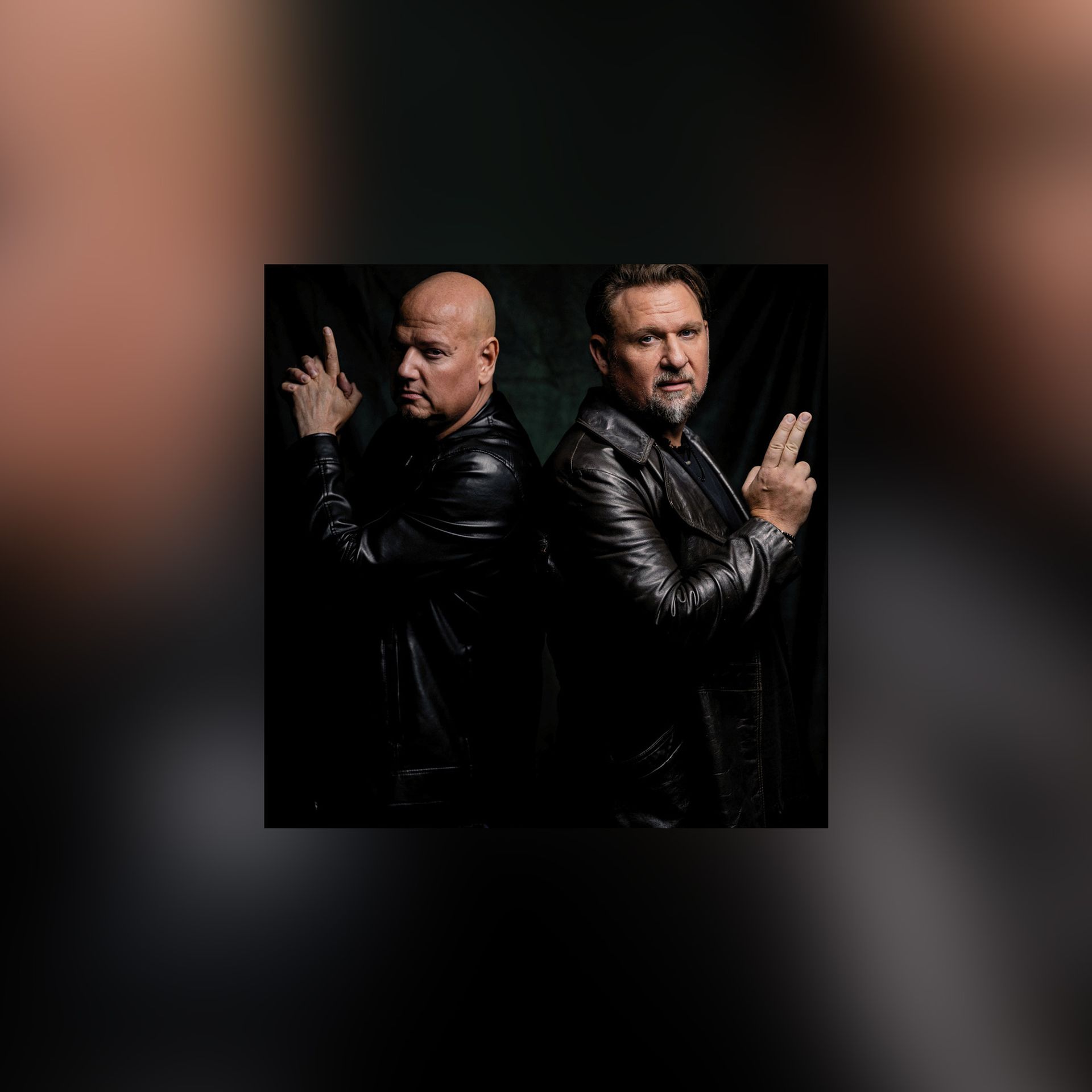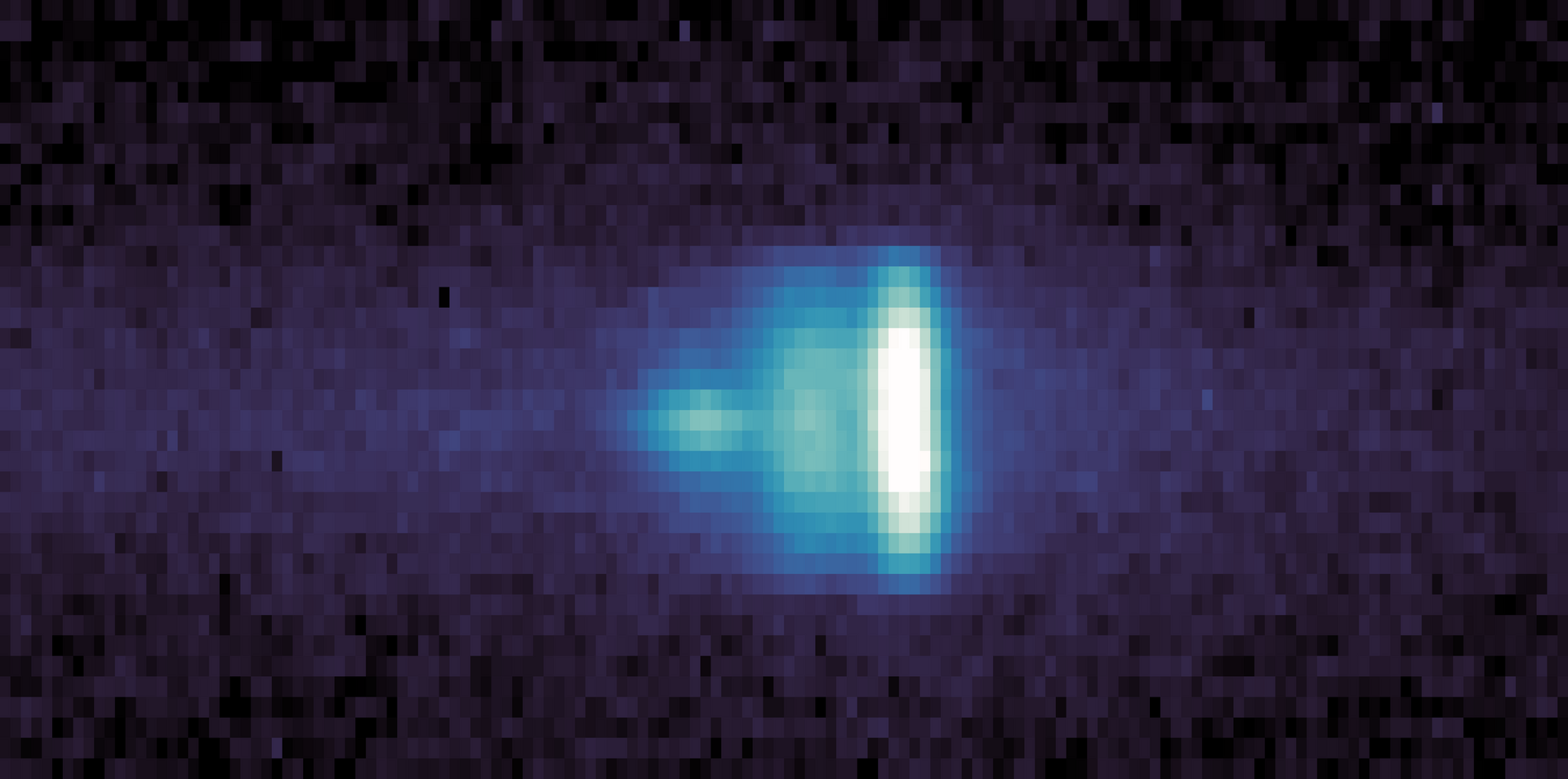DIE GESCHICHTE DES SCHLAGERS (4)

Source: Helene FIscher
4. Party, Techno, Atemlos
Wie zuvor schon erwähnt entstammen viele Schlager der Nachkriegszeit der Faschings- und Karnevalsszene. Ein Trend der über die Jahrzehnte nicht nachgelassen hat. Im Gegenteil: Schlager und Volksmusik nahmen zunehmend einen Eventcharakter an. Schlagerstars füllten nicht nur Hallen, sondern traten auch bei Umzügen und in Zirkuszelten auf. Später konnte man mit seinen Lieblingen von Funk und Fernsehen sogar auf Reisen gehen, Wallfahrten, Kreuzfahrten etc. Auch die Jugend blieb davon nicht unberührt. Das Wirtschaftswunder der 1950er brachte neue Reisemöglichkeiten, die sich durch den Fall der Sowjetunion Ende der 1980er nur noch erweiterten, und der Schlager wurde zu einem Guilty Plessure, dem man sich im Urlaub schon mal hingab - besonders wenn eine entsprechende Menge Alkohol involviert war. Eine Entwicklung die noch halbwegs tolerierbar gewesen wäre, hätte man den Techno aus dem Spiel gelassen...
In den 1970er und 80er Jahren entwickelte sich in den Staaten, unter anderem inspiriert von der Diskomusik a la Giorgio Moroder und den minimalistischen Rhythmen von Kraftwerk, eine Vielzahl unterschiedlicher Stile der Elektronischen Musik, darunter der Techno. Dieser erlebte in den 90er Jahren einen großen Hype, was der Schlagerpartie nicht verborgen blieb, die kurzerhand das ganze alte Zeugs aus dem Keller holte und mit etwas Bumm-Bumm neu auflegte. Es war die Geburtsstunde der neuen deutschen Party- und Saufkultur, die alle Generationen miteinander verband und saftige Gewinne abwarf. Auf einmal war der Schlager überall: Nicht nur an der Reeperbahn in Hamburg oder in den Bierzelten am Oktoberfest in München, sondern auch beim Après-Ski in den Almhütten, am Ballermann auf Mallorca, auf der Maturareise nach irgendwo. Nach langen Jahren des Nischendaseins war der Schlager endlich wieder im Mainstream angelangt.
Inzwischen wurde die Neue Deutsche Welle von der neu erwachten deutschen Pop- (Pur, Die Prinzen) und Hip Hop-Szene (Die fantastischen Vier, Freundeskreis), sowie der Hamburger Schule (Tocotronic, Die Sterne, Blumfeld) abgelöst. Neue deutschsprachige Musik abseits des Mainstreams wurde durch alternative Medien wie die Musiksender MTV und VIVA, das deutsche Magazin Spex und den österreichischen Radiosender FM4 zugänglicher gemacht. Neue Genres entstanden, kreierten ihr eigenes Zielpublikum, wie die Neue Deutsche Härte (Rammstein) oder Clicks & Cuts (Mouse on Mars, Alva Noto). Das Spektrum deutschsprachiger Musik wurde immer größer, nahm durch die Digitalisierung und der damit verbundenen, erleichterten Soundproduktion noch erheblich zu. Mit Beginn des 21. Jahrhunderts hatte sich der traditionelle Schlager allerdings auf ein relativ festgefahrenes Programm eingespielt, mit viel Hall in der Stimme und gefühlsbetonten Texten die in etwa so edgy sind, wie das Weiße in der Semmel. Der Partyschlager dem wir Interpreten wie DJ Ötzi oder Andreas Gabalier zu "verdanken" haben, knüpfte an den Trends der 90er an. Und der Schlagerpop, oder: Popschlager wie man heute auch sagt, orientierte sich stärker denn je am Mainstream - dabei häufig ein wenig hinterher hinkend, um auch ja den Nostalgiefaktor auszureizen - und präsentierte sich mit entsprechenden Bühnenshows. Bestes Beispiel: Helene Fischer.
Aber halt: Hatten Schlager und Volksmusik in all der Zeit keinerlei Einfluss auf den Underground? Oh doch, durchaus! Gerade in den vergangenen 30 Jahren hat eine erstaunliche Aufarbeitung stattgefunden. Durch österreichische Akteure wie Hubert von Goisern oder Attwenger entwickelte sich die Neue Volksmusik, auch Volxmusik oder Tradimix genannt, die sich mehr an der Weltmusik orientiert, eher subtilerer Elektronik bedient und Experimenten nicht grundsätzlich abgeneigt ist. Innerhalb der Hamburger Schule gab es Player wie Rocko Schamoni, der schnulzige Lieder mit viel Punk und Ironie hervorbrachte und der zusammen mit Schorsch Kamerun von den Goldenen Zitronen den für die Szene wichtigen Golden Pudel Club betrieb. Ihr Kumpel Heinz Strunk erzählt unterdessen in seinem Buch Fleisch ist mein Gemüse über seine Zeit in einer Tanzkapelle.
In Berlin gab es die Gruppe Stereo Total die französische, aber auch deutsche Schlager mit einer Mischung aus Elektronik und Rockabilly neu interpretierte. Dieweil sich die Jungs von Element of Crime nach Jahren des englischsprachigen Rocks durch die Musik von Brecht und Weill zu deutschsprachiger Musik umentschieden hatten und mittlerweile auch nicht mehr davor zurückschrecken Freddy Quinn zu covern. In Österreich gab es Gustav mit Rettet die Wale, die Laokoongruppe die in einem Will Oldham-Cover den Donauwalzer verwendet - wir erinnern uns: Der erste als solcher bezeichnete Schlager. Fritz Ostermayer von der FM4-Kultsendung Im Sumpf zeigt sich vom Schlager begeistert und auch sein Kollege Hermes scheut nicht davor zurück mit alten Couplets aufzuwarten. Kurzum: Die Toleranz dem alten Schlager gegenüber ist selbst im Underground nur gewachsen.
Wovon man sich aber nach wie vor distanziert ist der gesellschaftliche Eskapismus, der über jede ernstzunehmende Kritik hinwegtäuschende Nationalstolz, sind die verstaubten Ansichten und fragwürdigen Moralvorstellungen, die Showhuren und Geschäftemacher, die vor der Kamera mit den Fans hausieren gehen und Backstage über sie ablästern, während sie sich möglicherweise auch noch mit Alkohol und Kokain das Hirn wegbomben. Oder die Skandalträger, von denen man nie gedacht hätte wozu sie fähig sind. Fairerweise sollte man allerdings dazusagen, dass es all das in so gut wie jedem Genre gibt, wo Kohle zu machen ist! Beim traditionellen Schlager kommt halt erschwerend die Utopie hinzu, die man seinem Publikum malt und die schnell zu einer Dystopie aufgebauscht werden kann, wenn auch nur der kleinste Makel zu erkennen ist. Am Besten man bleibt authentisch und nimmt sich selbst nicht immer ganz so ernst! In diesem Sinne...
The End
#FEEDBACK