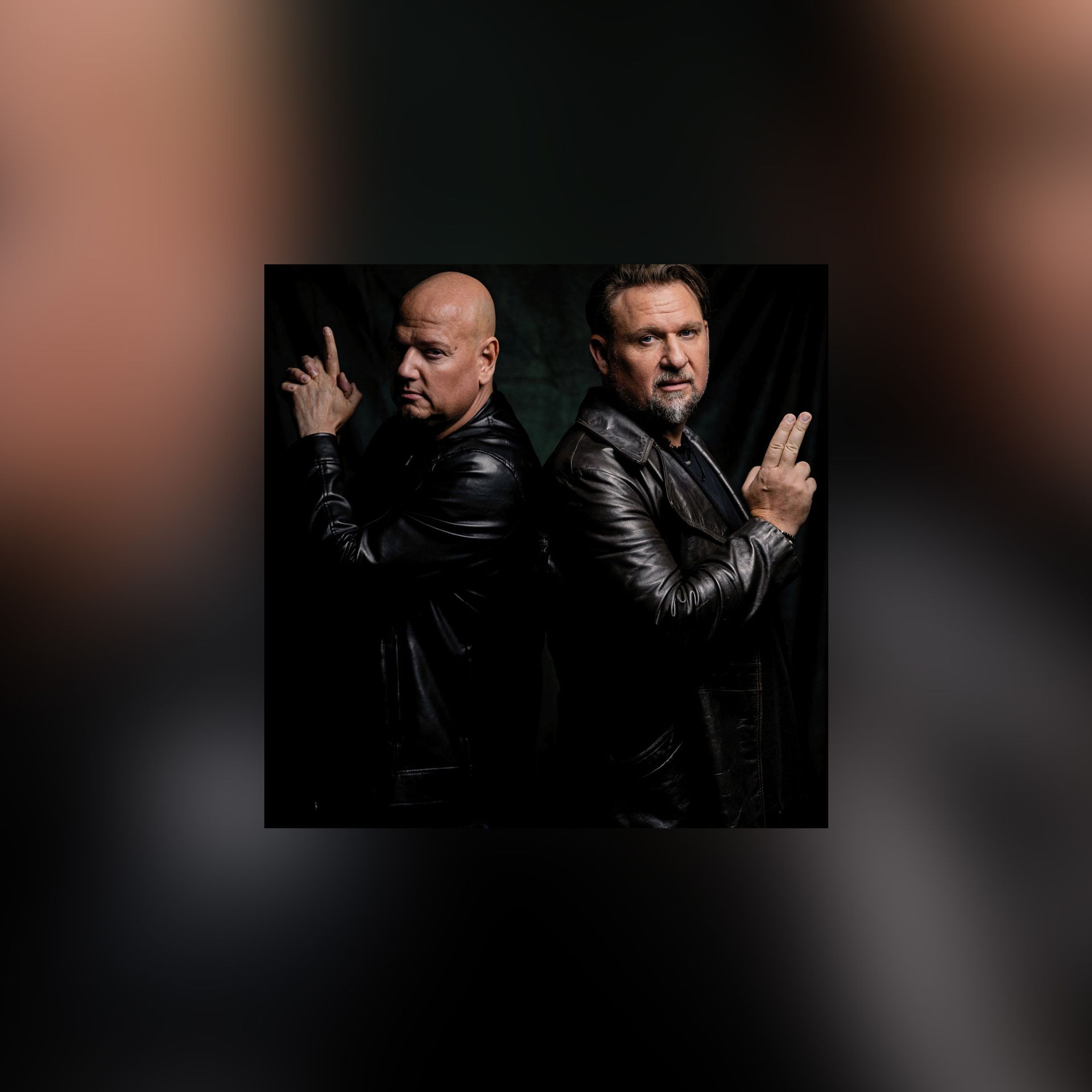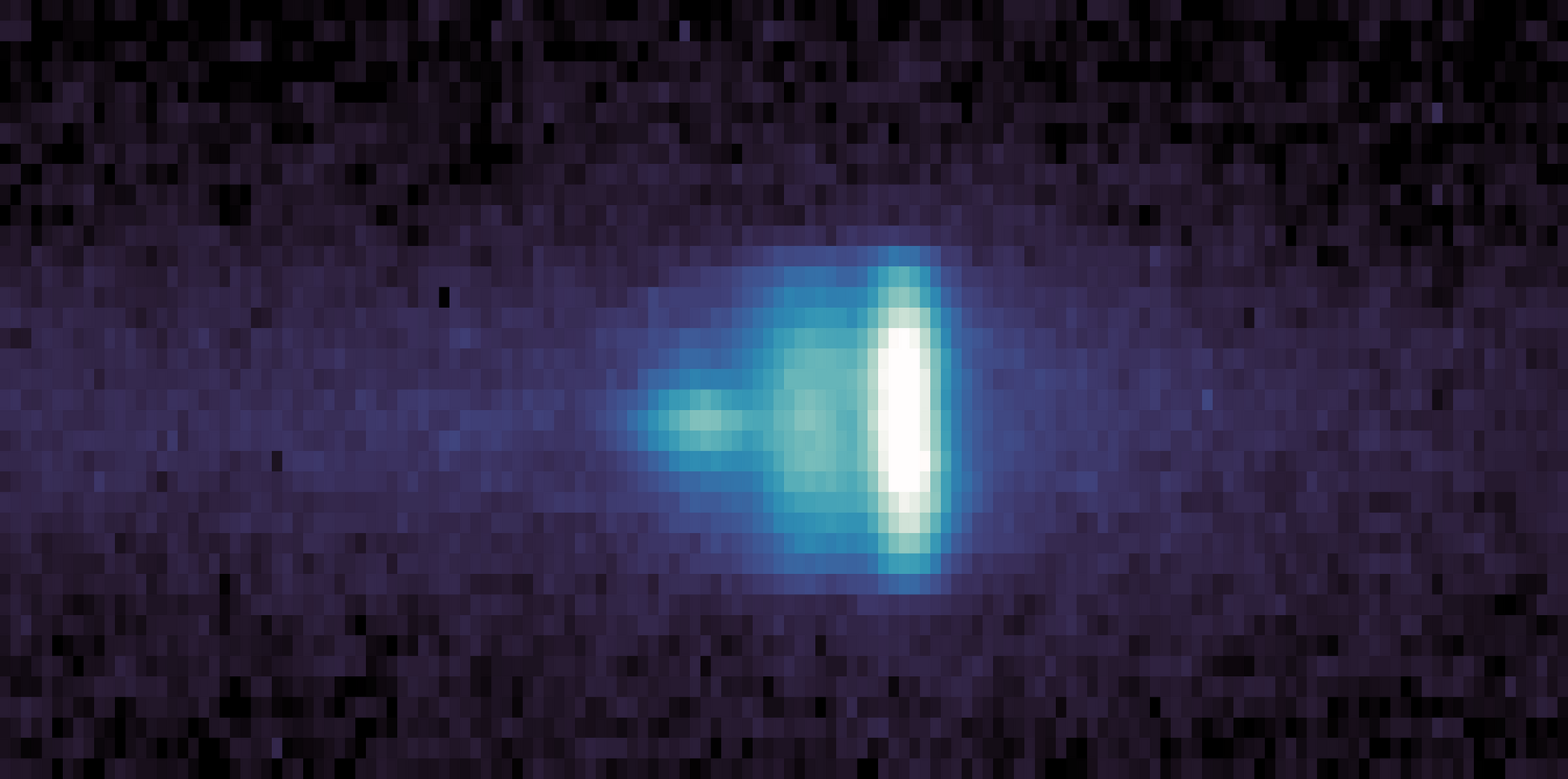UK-EXPORTS: RADIO COMEDY
2022 feiert die BBC ihr 100-jähriges Bestehen. Ihre bescheidenen Anfänge hatte der britische Sender selbstverständlich nicht im Fernsehen, sondern im Radio und natürlich gab es auch dort schon etliche Comedy-Programme, meist aus der Variety-Ecke. Während des Zweiten Weltkriegs dienten diese Sendungen der Truppenunterhaltung, danach bildeten sich einige mehr experimentelle, surreale und absurde Radioshows die den Grundstein für die spätere Comedyszene im Gesamten bildeten. Etliche von ihnen bekamen später eine eigene TV-Adaption und erlangten internationale Bekanntheit wie Little Britain oder die animierte Ricky Gervais Show. Im heutigen Artikel präsentieren wir einige nennenswerte Beispiele, manche bekannter als andere, aber alles in allem durchaus hörenswert und unglaublich komisch!
The Goon Show (1951 - 1960)
Eine Sendung die einen großen Einfluss auf die damals noch blutjungen Monty Pythons ausübte, war die Anfang der 1950er Jahre in Angriff genommene Hörspielreihe The Goon Show von Peter Sellers, Spike Milligan und Harry Secombe. Diese unterschied sich von anderen Hörspielen des BBC Home Service dahingehend, dass sie gespickt war mit völlig beknackten, surrealen Geschichten, aberwitzigen Wortgefechten und anarchen Soundspielereien aus dem Repertoire des stets experimentierfreudigen BBC Radiophonic Workshops.
Die Reihe erfreute sich höchster Beliebtheit und erreichte schnell Kultstatus. Ihr folgten Bühnenshows, Fernsehadaptionen, Bücher und mehr. Sie war auch ein großer Einfluss für den Humor der Beatles, im Speziellen John Lennon.
I'm Sorry, I'll Read That Again (1964 - 1973)
Ausgehend von der 1964 entstandenen Cambridge Footlights Revue, dem Cambridge Circus, entwickelten Tim Brooke-Taylor, Graeme Garden, Bill Oddie, John Cleese, Jo Kendall und David Hatch die Radiocomedy-Reihe Im Sorry, I'll Read That Again. Sie lief in neun Staffeln mit insgesamt 104 Folgen und war vor allem bei der damaligen Jugend sehr populär. Sie war auch ein gutes Versuchslabor für spätere Fernsehprojekte. Brooke-Taylor, Garden und Oddie machten sich in den 1970ern einen Namen als The Goodies. Cleese lieferte hier zusammen mit seinen späteren Monty Python-Kollegen Graham Chapman und Eric Idle Schreibarbeiten ab. Jo Kendall machte sich einen Namen als Schauspielerin und beliebte TV-Personality, wohingegen es David Hatch mehr in die diversen produktionsbedingten Funktion der BBC verschlug. Alles in allem hatte I'm Sorry, I'll Read That Again großen Einfluss auf die spätere britische Radiocomedy.
The Ricky Gervais Show (1998, 2001 - 2005)
Bevor sich Ricky Gervais und Stephen Merchant mit The Office einen Namen gemacht hatten, fabrizierten sie eine eigene Radioshow auf dem britischen Privatsender XFM (heute Radio X) in der sie über alles mögliche daher schwadronierten, das ihnen gerade in den Sinn kam. So richtig in Fahrt kam die Sendung aber erst nach ihrer Rückkehr im Jahr 2001, mit der Einbindung ihres etwas merkwürdigen neuen Produzenten Karl Pilkington und seiner komplett absurden Sicht auf die Welt. Oft macht es den Anschein der etwas autistisch anmutende Pilkington würde von Gervais und Merchant regelrecht verarscht und ausgebeutet, beim näheren hinhören stellt man allerdings fest, dass er selbst auch kein Unschuldsengel ist. In frühen Jahren soll er mit taktloser Kritik das schottische Model Gail Porter dazu gebracht haben in Tränen aufgelöst das Studio zu verlassen. Nach Ende der Radioshow fuhr das Trio mit eigenen Podcasts fort, die zwischen 2010 - 12 als nachanimierte Show im Hanna-Barbera-Stil auf HBO lief.
Kenny Everett (1964 - 94)
Maurice James Christopher Cole alias Kenny Everett begann seine Karriere Mitte der 1960er als Radio disc jockey für einen Piratensender, ehe er zu Radio Luxembourg und zahlreichen anderen Sender wechselte, die ihn nach einigen Kontroversen nicht selten vor die Tür setzten, nur um ihn dann reumütig wieder zurück zu holen. Sein großer Vorteil war, dass er sich mit zahlreichen Stars auf Augenhöhe bewegte, so setzte er sich unter anderem dafür ein, das Stück Bohemian Rhapsody von Queen salonfähig zu machen. Auch seine Talente als Comedian wurden schnell erkannt und ihm wurden eine Reihe schräger, surreal anmutender TV-Shows anvertraut, in denen auf kreative Weise mit dem damaligen Spezialeffekten experimentiert wurde. Everett outete sich Ende der 80er als homosexuell, was die Gerüchte anheizte er hätte etwas mit seinem langjährigen Freund Freddy Mercury gehabt - eine Behauptung die sich nie erhärtete. 1995 starb er an den Folgen einer Aids-Erkrankung. Sein enormer Einfluss auf die britische Popkultur ist aber auch heute noch zu spüren.
Blue Jam (1997 - 99)
In den frühen Morgenstunden des Jahres 1997 startete auf BBC Radio 1 die experimentelle Dark comedy und Horror-Reihe
Blue Jam von Chris Morris, gespickt mit absurd-surrealen Szenen, Ambient, Sound effects und Musik von Serge Gainsbourg, Björk, Aphex Twin, Massive Attack, Beck, Moby etc. Zum Cast gehörten Chris Morris, Kevin Eldon, Julia Davis, Mark Heap, David Cann und Amelia Bullmore, zum weitreichenden Autorenteam u.a. Graham Lineham (Black Books, The IT Crowd), Arthur Mathews, Peter Baynham, David Quantick, Jane Bussmann und Robert Katz. 2000 erschien eine CD bei Warp Records, im selben Jahr erschien die Fernsehadaption
Jam auf Channel 4.
#FEEDBACK