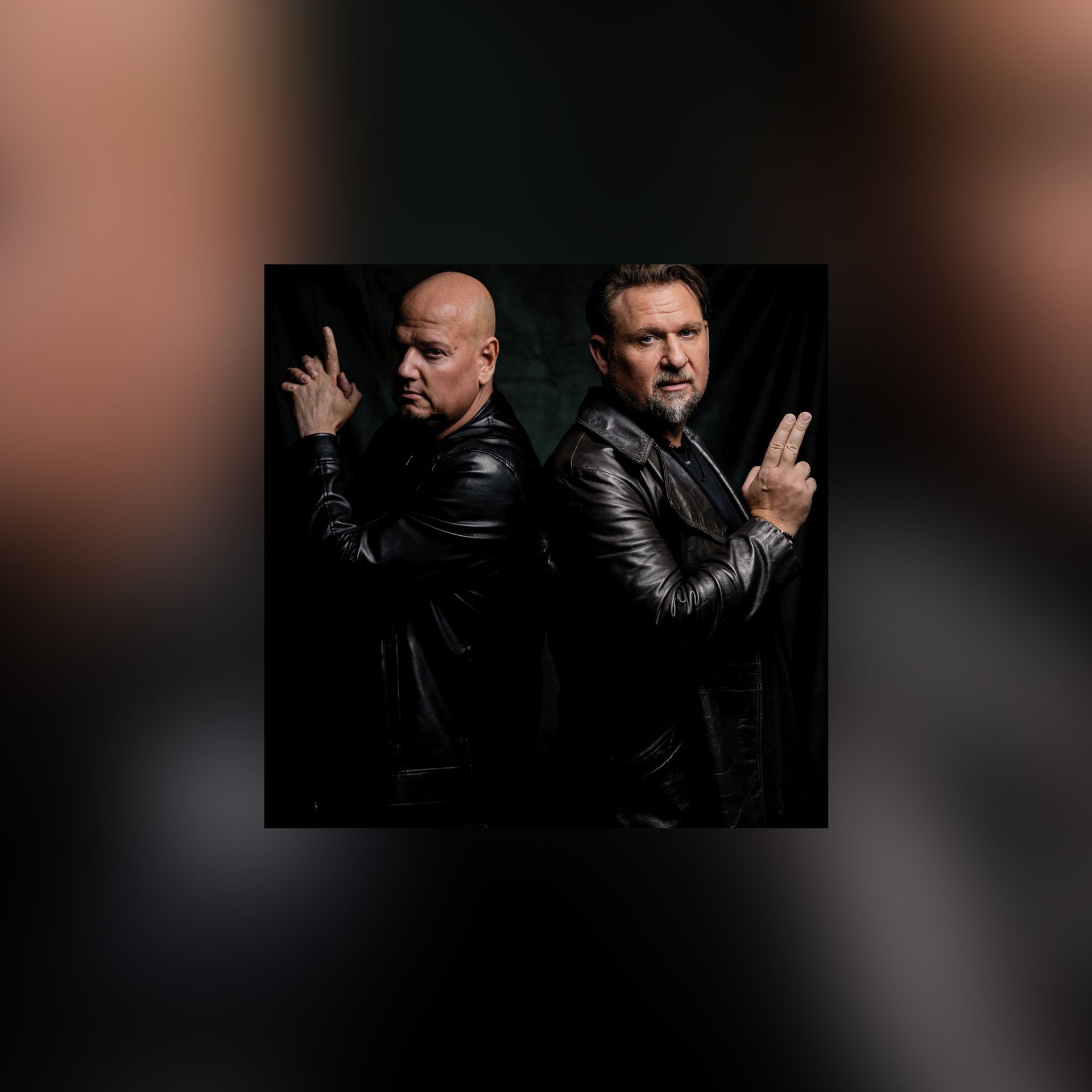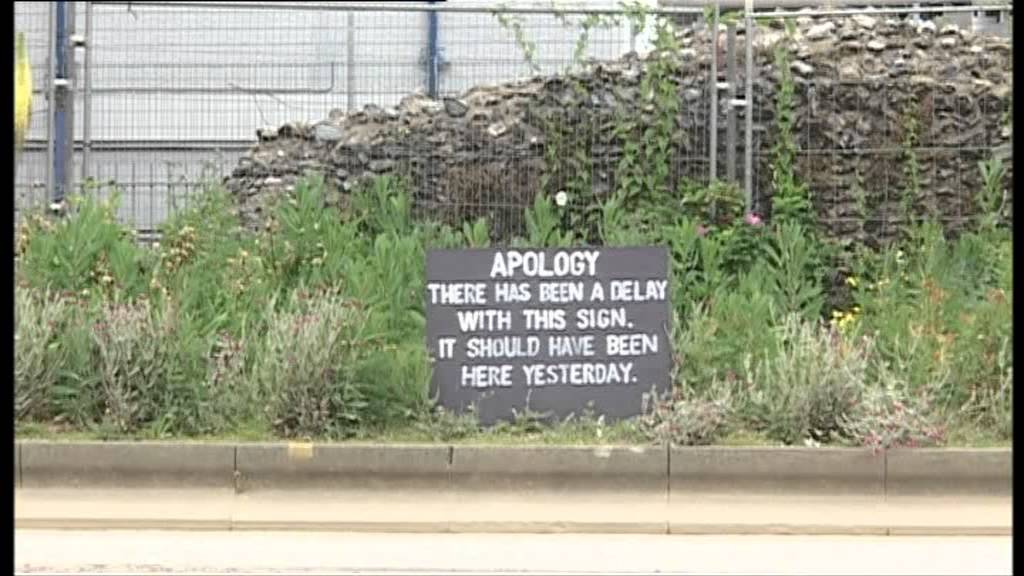UK-EXPORTS: 5 WEITERE COMEDY-PERLEN
And now for something completely different...
1. Kenny Everett (1944 - 95)
Maurice James Christopher Cole alias Kenny Everett begann seine Karriere Mitte der 1960er als Radio disc jockey für einen Piratensender, ehe er zu Radio Luxembourg und zahlreiche andere Sender wechselte. In dieser Rolle fand er sich mit zahlreichen Stars auf Augenhöhe und setzte sich unter anderem dafür ein, das Stück Bohemian Rhapsody von The Queen salonfähig zu machen. Auch seine Talente als Comedian wurden schnell erkannt und ihm wurden eine Reihe schräger, surreal anmutender TV-Shows anvertraut, in denen auf kreative Weise mit dem damaligen Spezialeffekten experimentiert wurde. Everett erregte stets Anstoß bei seinen Vorgesetzten, wie zum Beispiel der BBC. Man ließ ihn aber eine Menge durchgehen, da er stets prominente Gäste wie Cliff Richards, David Bowie u.a. im Gepäck hatte. Er outete sich Ende der 80er als homosexuell, was die Gerüchte anheizte er hätte etwas mit seinem langjährigen Freund Freddy Mercury gehabt - eine Behauptung die sich nie erhärtete. 1995 starb er an den Folgen einer Aids-Erkrankung. Sein enormer Einfluss auf die britische Popkultur ist aber auch heute noch zu spüren.
2. A Bit of Fry and Laurie (1989 – 95)
Hugh Laurie (der breiten Öffentlichkeit auch als Dr. House bekannt) und sein langjähriger Partner Stephen Fry begannen ihre Karriere in einer Zeit, als die Alternative Comedy wütete. Eine dem Punk verwandte Gegenbewegung zum verkopften Collegeboy-Humor der Pythons und den Wirren der Thatcher-Ära, wo das Publikum schon mal auf's Wüsteste beschimpft und mit Konventionen gebrochen wurde. Fry und Laurie waren natürlich mit von der Partie, wenn auch vergleichsweise zivilisierter unterwegs. An der Seite von Emma Thompson, Ben Elton, Robbie Coltrane (aka Hagrid) u.a. sollten sie einen ITV-Ableger für das erfolgreiche, von der BBC produzierte Satireformat Not the Nine O'Clock News mit Rowan Atkinson bilden. Das daraus resultierende Alfresco lief nur mässig, machte aber die BBC auf Fry, Laurie und Thompson aufmerksam, die ihnen eine eigene Show in Aussicht stellte. Das Trio produzierte daraufhin den Piloten für The Crystal Cube, eine Parodie auf die damaligen Wissenschaftsmagazine. Das Konzept floppte. Thompson zog wenig später nach Amerika, wo sie eine steile Karriere als Schauspielerin machte. Einige Jahre später gab die BBC Fry und Laurie eine zweite Chance und sie besannen sich auf eine klassische Sketchshow, die einen brillanten Balanceakt zwischen dem Pythonesken und der anarchen Energie der Alternative Comedy an den Tag legte, dabei niederschwellig und originell blieb. Mit A Bit of Fry and Laurie kam ihre Karriere erst so richtig in Schwung.
3. Absolutely Fabulous (1992 - 2012)
Weibliche Comedians von den britischen Inseln werden leider sträflich unterschätzt und finden in der breiten Öffentlichkeit nicht immer das Rampenlicht, das sie sehr wohl verdienen. Nennenswerte Beispiele sind die bereits erwähnte Emma Thompson und die wunderbare Tracey Ullman, die beide in die Staaten emigrierten. Die später ausgestrahlte Tracey Ullman Show erlangte übrigens Bekanntheit, weil in ihr eine kleine, aber feine Cartoonserie namens The Simpsons debütierte. Zu erwähnen seien auch Joyce Grenfell, Victoria Wood, Dawn French, Miranda Hart, Kathy Burke, Lorna Watson, Ingrid Oliver, Catherine Tate, Tamsin Greig und Michelle Gomez. Unter all diesen Talenten gab es aber ein unschlagbares Duo, dass nicht nur internationale Erfolge feierte, sondern auch das Frauenbild der Fernsehlandschaft für immer veränderte. Die Rede ist von Jennifer Saunders und Joanna Lumley mit ihrer legendären Sitcom Absolutely Fabulous, oder kurz: AbFab. Im Fokus stehen die kindsköpfige Unternehmerin Edina Monsoon und ihre lasterhafte Freundin Patsy Stone, die trotz ihres zunehmenden Alters versuchen immer noch einen extravaganten Lebenstil zu pflegen. Wobei auch sie an den täglichen Sorgen und Problemen nicht ungestraft vorbeikommen. Der Ton ist weniger elitär ladylike, wie man es bei den Briten vermuten würde, als ungewohnt derb und subversiv. Die Serie fand einen Ableger in Frankreich, eine amerikanische Version mit Carrie Fisher und Barbara Carrera schaffte es nicht in die Endphase. Allerdings verwandte Roseanne Barr, die für das Projekt verantwortlich zeichnen sollte, einige Ideen für die letzte Staffel ihrer eigenen Sitcom Roseanne. Absoluetely Fabulous inspirierte noch viele weitere Sitcoms mit fokussiert weiblichem Cast wie Cybill und High Society. 2016 kam ein Kinofilm zu Absolutely Fabulous heraus.
4. Goodness Gracious Me (1998 - 01 & 2014 - 15)
Die Briten haben auch multikulturell eine Menge zu bieten. Wie das vornehmlich mit Schotten und Walisern besetzte Sketchprogramm Absolutely. Die von Schwarzen und Asiaten präsentierte 90er Comedyshow The Real McCoy oder die Hitsitcom Citizen Khan mit Fokus auf eine britisch-pakistanische Familie. Ein großes Highlight ist die nach einem Evergreen von Peter Sellers und Sophia Loren benannte Sketchshow Goodness Gracious Me der britisch-indisch-pakistanischen Comedians Sanjeev Bhaskar, Kulvinder Ghir, Meera Syal und Nina Wadia. Sie setzte sich vornehmlich mit den Unterschieden und Konflikten zwischen den Kulturen auseinander und wechselten dabei desöfteren die Perspektiven. Auch wurden immer wieder die verschiedensten Parodien auf Machwerke der modernen Popkultur gemacht, wie The Six Million Rupee Man, The Delhi Tubbies und The Marriage Emporium (eine Parodie auf Monty Python's Cheese Shop- und Dead Parrot-Sketch).
5. Dare To Believe (2002 - 04)
Zu guter Letzt etwas aus der experimentierfreudigeren Ecke:
Dare To Believe war eine früh morgens auf ITV ausgestrahlte Sketchshow mit mehreren, wiederkehrenden, kurzweiligen Beiträgen die auf Konzepte des Surrealismus und Dadaismus aufbauen. Sie stammte aus der Feder von
Tim de Jongh,
Tim Firth
und
Michael Marshall Smith, die dem britischen Publikum auch aus der BBC Radio 4-Show
And now in Colour
(1990/91) bekannt sind. Eine Fundgrube für Freunde des schrägen Humors und Memes, wie dem
Aguamoose Man,
Departement of
Environment Otter Survey und dem ewigen Mantra:
"Fly like a mouse. Run like a cushion. Be the small bookcase."
#FEEDBACK