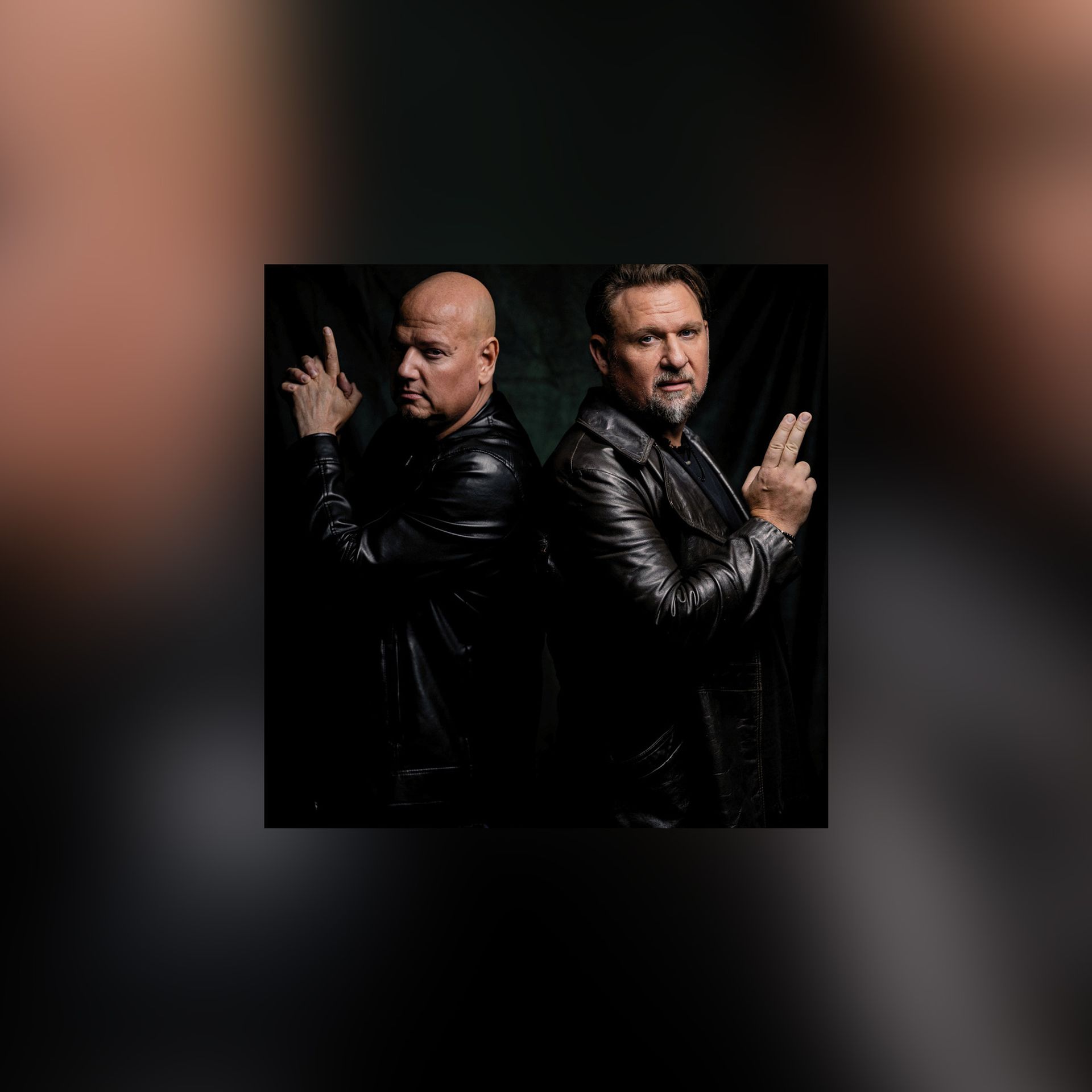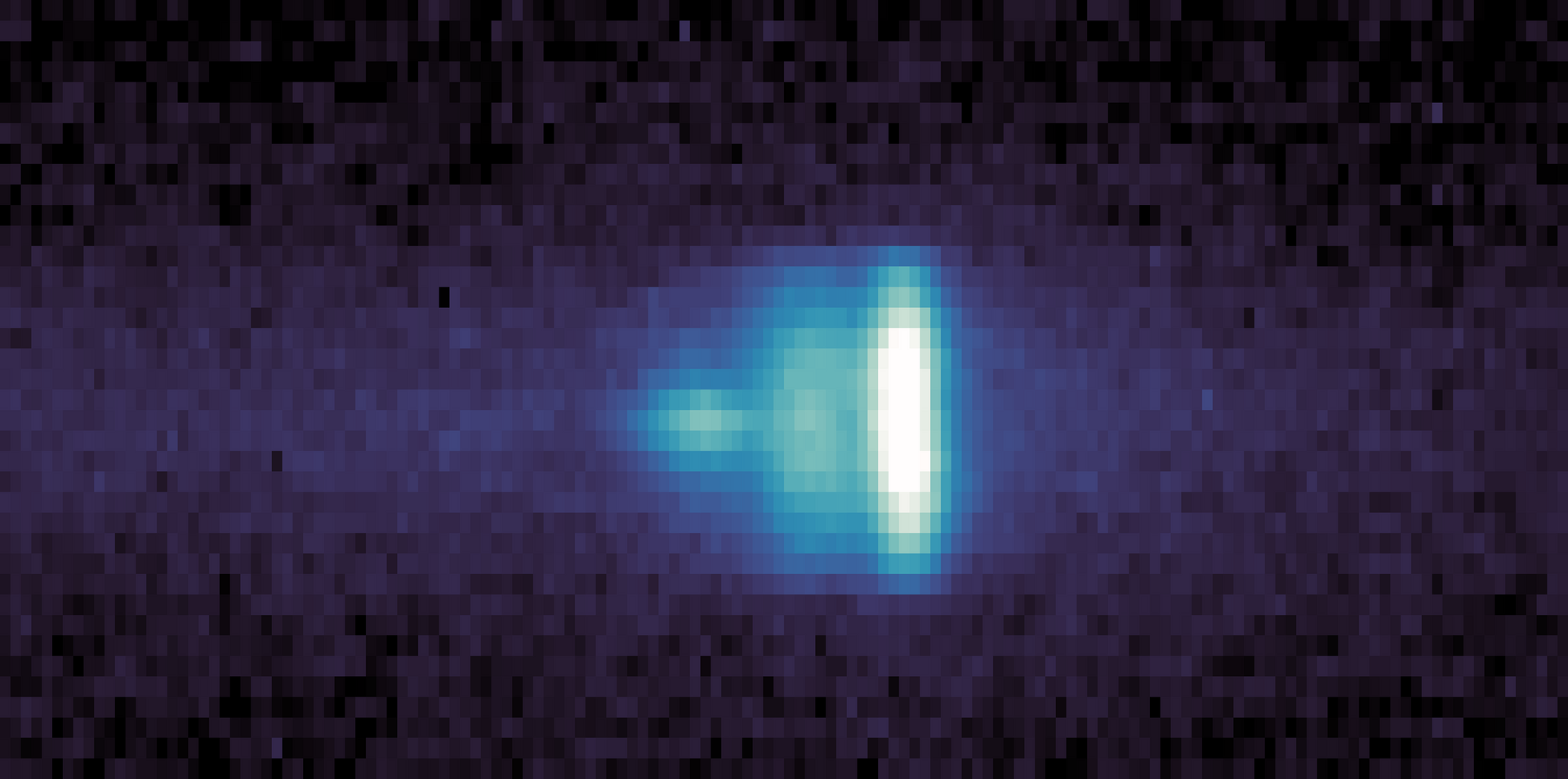DIE GESCHICHTE DES SPAZIERGANGS
Eine der einfachsten und doch unterschätztesten Dinge die man tun kann: Spazieren gehen!

Photo (C) by Daria Obymaha
Man geht davon aus, dass die Vorfahren des Menschen vor 5 - 6 Millionen Jahren dazu übergingen sich des aufrechten Ganges zu bedienen. Über die genauen Beweggründe gibt es mehrere Theorien: Erhöhte Sichtbarkeit, Effizienz beim Laufen, Thermoregulation... Es hatte jedenfalls zur Folge, dass sich ihr Gehirn auf die neuen Gegebenheiten anpassen musste, erforderte eine größere Kontrolle über Muskeln und Knochen, einschließlich der Wirbelsäule, des Beckens und der Beine. Es mussten komplexere Informationen verarbeitet werden, wie der Gleichgewichtssinn, die Tiefenwahrnehmung, die räumlichen Orientierung und räumliches Denken. Dies stimulierte vor allem die Entwicklung des präfrontalen Kortex und des Kleinhirns, die eine massive Rolle in der Evolution hin zum modernen Menschen spielten.
Wir haben dem aufrechten Gang also eine Menge zu verdanken! Und doch nehmen wir ihn viel zu leichtfertig und unterschätzen was er immer noch für uns tun kann, besonders wenn es darum geht Inspiration zu tanken. (Was ja, wie hoffentlich mittlerweile etabliert, unser Steckenpferd ist hier beim Kollektiv-Magazin!) Man sieht die Leute allerorts auf den Straßen, gedankenverloren, den Kopf vornüber gebeugt auf ihre Handys hinabstarren und wundert sich, warum die Menschen immer dümmer werden! Zumal es soviel zu sehen gäbe, selbst an Orten an denen man jeden Tag wie selbstverständlich vorbeiläuft. So viele Möglichkeiten zu entdecken, zu reflektieren, projizieren!
Um dem "Gehen" wieder mehr Liebe zukommen zu lassen, aber auch um über einige seiner ungeahnten Möglichkeiten zu informieren, wollen wir euch einladen uns auf einen Spaziergang durch die Geschichte des Spaziergangs zu begleiten...
Der Müßiggang
Der Müßiggang bezeichnet heute umgangssprachlich das freie, entspannte umherstreifen ohne jede Pflicht oder erholende Absicht. Meist steht es in Verbindung mit geistigen Genüssen oder leichten Vergnügungen. Man frönt schlicht der "Muße", also der Zeit die einem für sich selbst zur Verfügung steht und nicht mit einer praktischen oder sinnerfüllten Tätigkeit einhergehen muss, wie es in der Freizeit oder der im englischen Sprachraum geläufigeren "Quality Time" der Fall ist.
Dabei hat der Müßiggang seine Wurzeln in durchaus konstruktiven Tätigkeiten: In der Antike nutzten vor allem die Philosophen den Müßiggang um die Welt zu betrachten, das Erlebte in Ruhe zu verarbeiten und sich ausgiebig Gedanken darüber zu machen. Er war ein wichtiger Teil ihres Studiums und lieferte einige erstaunliche Ergebnisse, von denen leider nur eine Handvoll überliefert wurden.
Dass er oft mit Faulheit oder gar Laster in Verbindung gebraucht wird, verdanken wir der christlichen Theologie im Mittelalter, die Faulheit/Trägheit den sieben Todsünden zuschrieb. Im Protestantismus die Arbeit und Beruf als wichtige Grundpfeiler unserer Gesellschaft betrachteten, und deren Lehren später Max Weber's Schriften zum Frühkapitalismus inspirierten - das nur am Rande - verkündete man gar: "Müßigkeit ist aller Laster Anfang." Ein Satz der nicht zuletzt vom dänischen Philosophen Søren Kierkegaard relativiert wurde, der schrieb:
„An sich ist Müßiggang durchaus nicht eine Wurzel allen Übels, sondern im Gegenteil ein geradezu göttliches Leben, solange man sich nicht langweilt.“
Heute wird der Müßiggang dadurch gerechtfertigt, dass man ihn mit einem erholsamen Spaziergang, einem Minimum sportlicher Ertüchtigung, mit Wellness oder meditativen Tätigkeiten in einen Topf wirft. Schon Friedrich Nietzsche äußerte sich zum Thema:
„Die Arbeit bekommt immer mehr alles gute Gewissen auf ihre Seite: Der Hang zur Freude nennt sich bereits ‚Bedürfnis der Erholung‘ und fängt an, sich vor sich selber zu schämen. ‚Man ist es seiner Gesundheit schuldig‘ — so redet man, wenn man auf einer Landpartie ertappt wird. Ja, es könnte bald so weit kommen, dass man einem Hange zur
vita contemplativa (das heißt zum Spazierengehen mit Gedanken und Freunden) nicht ohne Selbstverachtung und schlechtes Gewissen nachgäbe.“
Wie man es dreht und wendet: Das Gehen tut uns gut, fördert den Geist und bringt die kreativen Säfte zum fließen...
Flanieren
So wichtig wie das Gehen für Körper und Geist ist, so unterschiedlich sind die Arten und Weisen dies zu tun: Man kann eine Runde um den Block gehen, möglicherweise in Begleitung eines Vierbeiners. Man kann eine Strecke, die man sonst mit Auto, Fahrrad oder anderen Verkehrsmitteln zurückgelegt hätte, zwecks der Entschleunigung etwa, zu Fuss absolvieren. Man kann aber auch planlos umherstreifen, sich treiben lassen, die Menschen und Dinge betrachten, Landschaft und Architektur bewundern. Ein beliebtes Synonym für letzteres Beispiel ist das sogenannte "Flanieren".
Was das Flanieren zu früherer Zeit vom bloßen Spazieren unterschied, war dass es nicht allein darum ging zu sehen, sondern gesehen zu werden. Man ließ sich "anschauen", zeigte Präsenz und hatte Gelegenheit seinen Status zur Schau zu stellen. Keine ganz ungefährliche Angelegenheit, denn fiel man unangenehm auf wurde man schnell zum Opfer von Klatsch und Tratsch. Aus diesem Milieu heraus entwickelte sich die literarische Figur des Flaneurs, eines intellektuellen Beobachters der über die Dinge reflektiert und fachsimpelt, die ihm auf seinem täglichen Spaziergang über den Weg laufen. Er selbst zeigt sich dabei eher distanziert und über den Dingen stehend.
Sein weibliches Äquivalent war die Passante, die als Figur insofern spannender war, als dass sie sich zusätzlich über die herablassende oder besitzergreifende Art ihrer Mitmenschen erheben musste. Frauen die ziellos und ohne Begleitung umherspazierten galten damals leicht als lasterhaft. Ein chauvinistisches Bild, das zum Glück durch die zunehmende Mobilisierung und soziale Aufklärung abnahm. Nicht zuletzt dank des enormen Engagements der Frauen selbst. Es ist beeindruckend zu bemerken, dass das Flanieren auch als politisches Statement seine Berechtigung hatte und in vielerlei Weise immer noch hat. In der Sichtbarmachung von Diversität in Kultur, Religion und Identität etwa, die von vielen zweifelhaften Seiten leider immer noch in die Abnormität gedrängt werden möchte. Umso wichtiger ist der freie Zugang in den Öffentlichen Raum - ohne Furcht vor Repression!
Auch wenn dem klassischen Flanieren schon vor langer Zeit der Tod beschieden wurde, finden sich heute noch weitreichende Beispiele für entsprechende oder ähnliche Motive. Man nehme nur die Wiener Kaffeehausliteratur, wo man als Autor bei einer gemütlichen Tasse Espresso sitzen und auf einem Schreibblock seine Beobachtungen notieren kann! Was die Flaneure und Passanten betrifft, findet man eine etwas zeitgenössischere Entsprechung im Phoneur, ein Begriff der 2005 von Kulturwissenschaftler Robert Luke definiert wurde. Diesem steht zusätzlich zu seinen persönlichen Beobachtungen und seinem Intellekt (falls überhaupt vorhanden), das gesamte Wissen des Internets zur Verfügung, das er auf Knopfdruck von seinem Mobilgerät abrufen kann. Was paradox ist wenn man bedenkt, dass dies mit "Treiben lassen" nur noch sehr wenig zu tun hat.
Promenadologie
1976 unternahm der Schweizer Soziologe Lucius Burckhardt ein soziales Experiment mit StudentInnen der Universität Kassel, den sogenannten "Urspaziergang". Er führte die Gruppe entlang eines vorgeplanten Weges nahe des Dorfs Riede und stellte die Aufgabe im Anschluss die besonders in Erinnerung gebliebenen Orte auf einer Karte zu verzeichnen. Darauf ergaben sich Übereinstimmungen die auf eine gemeinsame Vorprägung der Landschaftswahrnehmung hindeutete. Manche der Teilnehmer erinnerten sich sogar einen Brunnen gesehen zu haben, der nicht existierte, wohl ausgelöst durch eine situationsbedingte Assoziation mit dem Volkslied "Am Brunnen vor dem Tore".
Aus diesem Experiment begründete Burckhardt mit seiner Frau, der Künstlerin Annemarie Burckhardt die kulturwissenschaftliche und ästhetische Methode der "Promenadologie", auch "Spaziergangswissenschaft", englisch: "Strollology". Darin geht es um die Wahrnehmung von Umwelt und deren Erweiterung, auch im urbanen Umfeld. Spielte die Promenadologie erst eine größere Rolle im Diskurs um Stadt- und Landschaftsplanung, der Verbesserung der Lebensqualität und Sicherheit in den Städten, gewann sie auch zunehmend in der Kunst an Bedeutung. Unter anderem entwickelte sich daraus das Konzept des Stadtspaziergangs, das heute zunehmend an Beliebtheit gewinnt.
Der Stadtspaziergang funktioniert nach ähnlichen Methoden wie die (historische) Stadtführung oder das "Sightseeing" im Tourismus, hier wird allerdings ein stärkeres Bewusstsein für die Umgebung geschaffen und mitunter auch aktionistisch und narrativ auf andere Kunstformen zurückgegriffen. Oft braucht es nicht mal einen Führer im eigentlichen Sinne, um sich auf einen Stadtspaziergang zu begeben. Man kann sich auch auf einen vorgelegten Pfad oder eine Spurensuche begeben, die im Vorfeld präpariert wurden, um ein immersives Entdecken und Erleben zu ermöglichen. Oder man folgt den Spuren einer literarischen Figur in einem Buch, wie es Leser von James Joyce's "Ulysses" zu tun pflegen, wenn sie sich - gar am
Bloomsday -
in Dublin aufhalten.
Auch hier finden sich erste Ansätze moderne Technologien in den Prozess mit einzubinden. Etwa durch Augmented Reality (siehe: Pokémon GO) oder Geocaching, auch als GPS-Schnitzeljagd bezeichnet. Oder Alternate Reality Games, kurz ARG genannt, über die wir im Rahmen unserer Artikelreihe Dark Oddities bereits mehrmals sprachen. (Beispiel: Dark Oddities #3 (ARG Edition))
Epilog
Ein wichtiger und auch oft unterschätzter Aspekt des Spaziergangs ist das nachhause kommen. Die Freude an relativ einfachen Dingen, wie das Schlüpfen in die gemütlichen Hausschuhe oder ein warmes erholsames Bad. Wenn man sich nochmal zurücklehnen kann und die gesammelten Eindrücke verarbeiten. Man mag sich fragen: War es nicht der Sinn und Zweck des Spazierganges sich zu erholen? Und da ist sie: Die Krux an der Sache! Wie soll man sich erholen, wenn man mit so vielen Sinneswahrnehmungen bombardiert wird? Wenn das Hirn stimuliert und man angeregt wird, über hundert Dinge nachzudenken, die Inspiration nur so sprudelt? Ganz zu schweigen von den Leuten denen man begegnet, Gespräche die man führt, Probleme und Lösungsansätze die man bespricht, die Gedanken und Emotionen die man davon trägt. Da kann man mal sehen wie leicht es in einem doch arbeiten kann, ohne dass es Anderen auffällt! Und wie leicht es doch ist einen guten Spaziergang zu unterschätzen...
#FEEDBACK