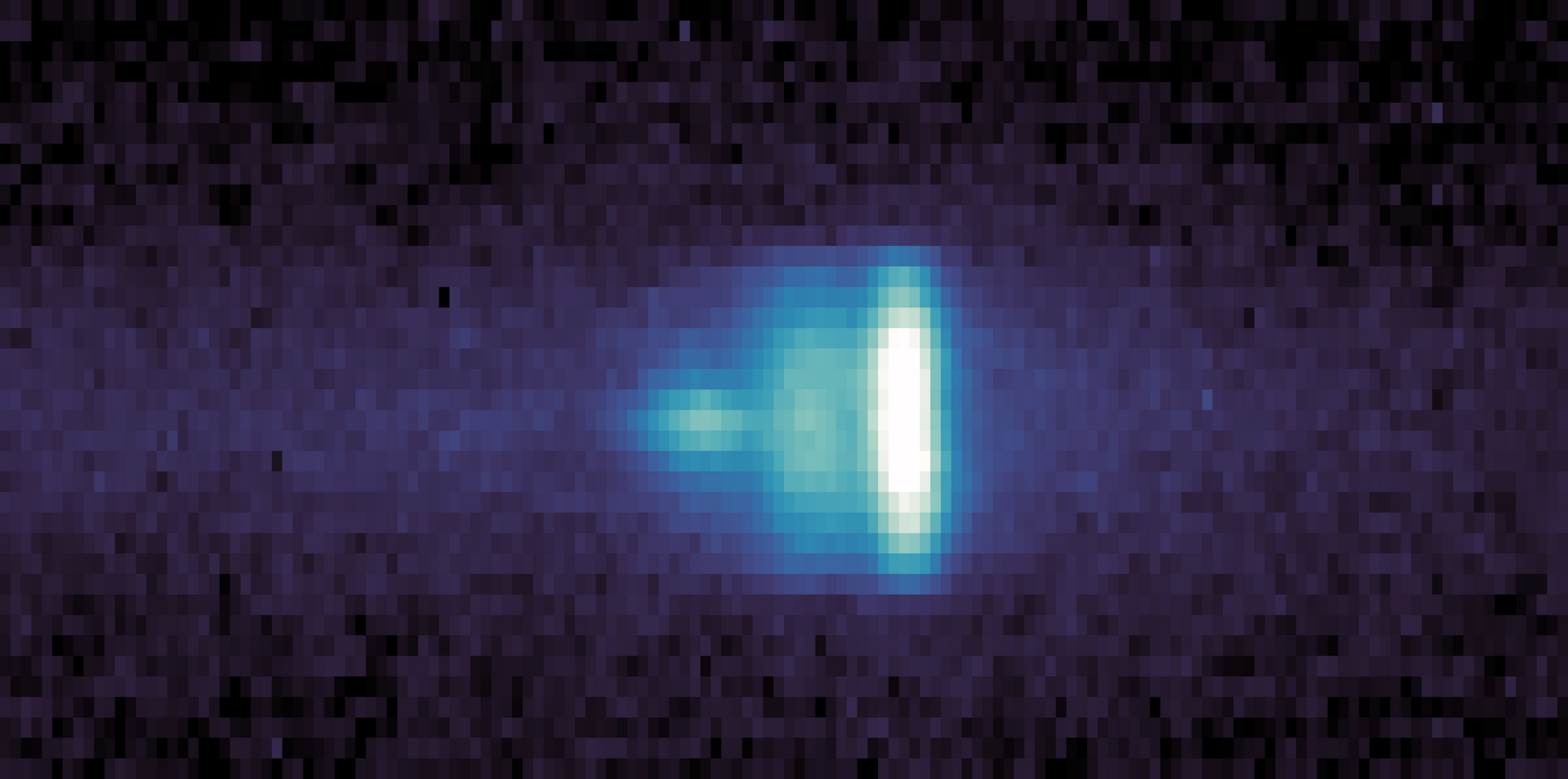PLUNDERPHONICS - ALLES NUR GEKLAUT?

In den frühen 1940ern nahm der ägyptische Komponist und Pionier der elektroakustischen Musik, damals Student in Kairo, Halim El-Dabh eine Zār-Zeremonie, eine Art Exorzismus, auf Tonband auf und verfremdete die Aufnahmen später. Das dabei erzeugte Stück "The Expression of Zaar" wurde 1944 in einer Galerie präsentiert. Es handelt sich dabei um das vermutlich älteste Beispiel der Musique Concrète.
Ihm folgten weitere Vertreter der Bewegung, wie ihr französischer Namensgeber Pierre Schaeffer, Pierre Henry, der Deutsche Karlheinz Stockhausen und der Grieche Iannis Xenakis, um nur Einige zu nennen. Unabhängig von ihnen experimentierte auch der japanische Komponist Tōru Takemitsu mit dem Medium Tonband. Das sich aus der Musique Concréte entwickelnde Konzept der Montage oder Sound collage bildete den Grundstein für das heute bekannte Sampling, welches durch entsprechende Geräte enorm erleichtert wurde: Schluss mit dem Zerhackstückeln und feinsäuberlichen Neuarrangieren von Magnetbändern - mit ein paar Knopfdrücken war die Sache gegessen!
Es gab nur ein Problem bei der Sache: Das Copyright. Selten hatten die Musiker die sich des Samplings bedienten die Rechte an dem Material das sie verwendeten. In Amerika gab es zwar die sogenannten "Fair use laws" welche eine limitierte Benutzung fremden Materials ohne Zustimmung der Rechteinhaber einräumten, sofern gewisse Auflagen eingehalten wurden. In manchen Fällen wurden dadurch aber Künstler um eine Menge Schotter gebracht. Bekanntestes Beispiel ist der sogenannte "Amen Break", ein siebenminütiger Ausschnitt aus der 1969 erschienenen Single "Amen, Brother" der Funk & Soul-Gruppierung The Winstons, welcher heute vor allem durch seine prominente Verwendung im Drum and Bass zu den am häufigsten verwendeten Schnipseln der Musikgeschichte zählt. Hier ein Beispiel:
In etlichen Fällen wurden Musiker aber auch zur Kasse gebeten, da sie sich unerlaubt beim Material anderer bedient hatten. Als besonders empfindlich hat sich dabei die Düsseldorfer Formation Kraftwerk erwiesen, die in den mehr als 50 Jahren ihres Bestehens mit Klagen nur so um sich geschmissen hat. Im Fall von Sabrina Setlur, für deren Song "Nur mir" aus dem Jahr 1997 der Produzent Moses Pelham zwei Sekunden(!) aus dem Kraftwerk-Klassiker "Metall auf Metall" gesampelt hatte, kam es zu einem Rechtsstreit der ganze 20 Jahre anhielt. 2016 entschied das Gericht zugunsten von Setlur, das Urteil wurde aber 2019 vom Europäischen Gerichtshof gekippt.
Die Copyright-Frage spaltet die Musikindustrie bis zum heutigen Tag. Aber zurück in die Vergangenheit, zurück zum Zeitalter der Sound collage und zu einem Visionär der ganz andere Vorstellungen hatte, wie mit der Sampling-Frage zu verfahren sei: John Oswald. 1985 veröffentlichte der kanadische Komponist einen Aufsatz betitelt mit Plunderphonics, or Audio Piracy as a Compositional Prerogative der wie folgt beginnt:
Musical instruments produce sounds. Composers produce music. Musical instruments reproduce music. Tape recorders, radios, disc players, etc., reproduce sound. A device such as a wind-up music box produces sound and reproduces music. A phonograph in the hands of a hip hop/scratch artist who plays a record like an electronic washboard with a phonographic needle as a plectrum, produces sounds which are unique and not reproduced - the record player becomes a musical instrument. A sampler, in essence a recording, transforming instrument, is simultaneously a documenting device and a creative device, in effect reducing a distinction manifested by copyright.
Sampling - Nicht bloße Zweckentfremdung origineller Versatzstücke, sondern ein Instrument mit eigener Identität und Originalität. Das ist die Idee von Plunderphonics! Und nicht wie heute oft fälschlicherweise geglaubt, das bewusst diebische Neuarrangieren populärer Werke, zwecks der Aufmerksamkeit. Hier wird im Grunde in dieselbe Kerbe geschlagen wie im Bereich der Micromontage, wo mit extrem verkürzten Samples gearbeitet wird (vgl. Microhouse, Akufen) oder der bereits 1960 von Iannis Xanakis erfundenen Granularsynthese, die noch einen Stück weiter geht, und völlig neue Klänge aus einer Aneinanderreihung vieler unterschiedlicher, feingeschnittener Klänge erzeugt.
Gleichzeitig unterstreicht Oswald die Daseinsberechtigung des bereits in den 1970ern praktizierten Turntablism im HipHop. Im Gegensatz dazu bedient sich Plunderphonic aber dem Reinklang der Samples, ohne sich von Copyright-Einschränkungen ins Handwerk pfuschen zu lassen. Im Gegenteil: Hier wird bewusst gegen die rigorosen Einschränkungen der Kunst protestiert. Dass es bei soviel Engagement regelmäßig zu Rechtsstreitigkeiten kommt ist abzusehen. Dem enormen Einfluss der Plunderphonics tut dies allerdings keinen Abbruch. Man nehme nur die diversen inoffiziellen Mashups die heutzutage im Netz kursieren, wie "The Grey Album" von Danger Mouse, das sich aus dem "White Album" der Beatles und dem "Black Album" von Jay-Z zusammensetzt. Oder Vaporwave, das meist nur aus verlangsamten Samples alter Popnummern besteht und als Subgenre des Plunderphonics gilt.
John Oswald veröffentlichte selbst seit den 1980ern unter dem Namen Plunderphonics entsprechende Alben, in denen er Material von Gruppen wie den Doors, Michael Jackson und vielen mehr durch die Mangel nahm...
#FEEDBACK