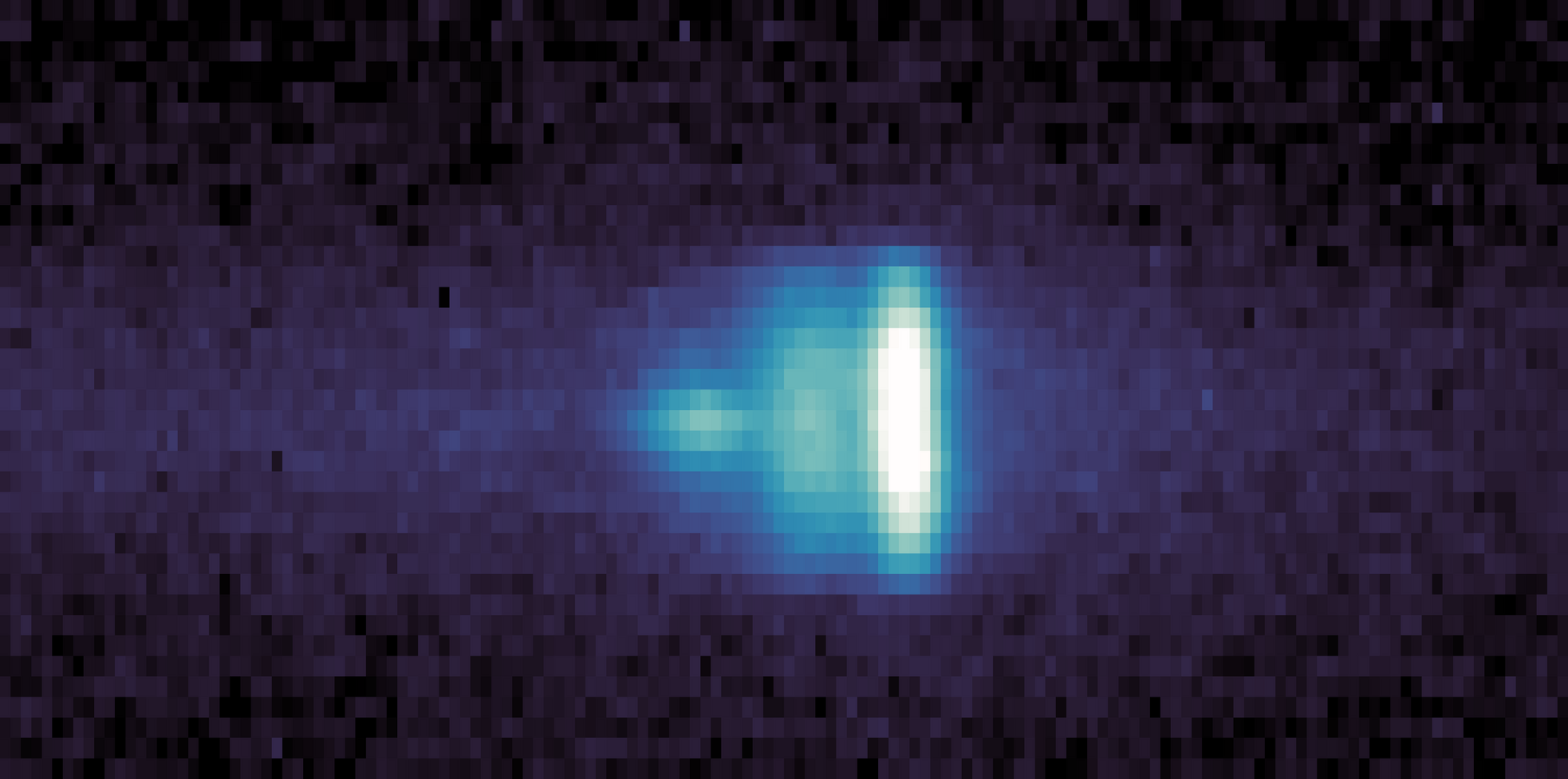LABOR L'ART - WERKE STATT PRODUKTE
2014 gründete das Kunstkollektiv Bureau du Grand Mot sein eigenes Netlabel. Aber was unterscheidet Labor L'art von anderen Labels...
Brandt & Flicker
- Brandt & Flicker (2019)
Zunächst Grundsätzliches
Damit Tantiemen hereinkommen muss man schon sehr viele Konzerte geben und regelmäßig im Radio gespielt werden, also "in die Rotation kommen". Zwar hat sich der Anteil heimischer Musik zB im öffentlich-rechtlichen ORF gesteigert - nicht zuletzt nach einem unschönen Shitstorm ausgelöst durch einen Kommentar von Ö3-Moderatorin Elke Lichtenegger vor etlichen Jahren, siehe hier
- das ändert aber nichts an der Tatsache, dass Österreich ein kleines Land ist und ein nicht unbedeutender Marktanteil bei Privatsendern liegt, die lieber mit internationalen Hits punkten, statt heimische Bands zu fördern.
Auch die Freien Radios helfen da wenig, zahlen diese doch einen Pauschalbetrag an die AKM, da es für sie so gut wie unmöglich ist, die Musikauswahlen all ihrer freien RadiomacherInnen zu dokumentieren. (Ein Pauschalbetrag übrigens, der MusikerInnen deren Output unter Creative Commons
läuft auch komplett ignoriert.) Gut: Wer häufiger spielt und gespielt wird, bei dem kommt schon ein bisschen was zusammen und über das System lassen sich auch durchaus Förderungen lukrieren. Aber reicht das?
Label sind auch so eine Sache: Sie ermöglichen es einer Band zwar ein größeres Publikum zu erreichen und Platten zu verkaufen. Von dem Geld das hereinkommt zwackt sich das Label aber auch seinen Teil ab. Verwaltung, Vertrieb, Promotion... das sind alles Dinge die bezahlt werden wollen. Hinzu kommt, dass manche Labels, insbesondere Major-Labels, dazu neigen Bands die bei ihnen unter Vertrag stehen einzubremsen, um eine andere Gruppe mit der sie im Moment mehr Geld machen können zu pushen. Es soll sogar Fälle gegeben haben in denen Bands nur unter Vertrag genommen wurden, weil sie den Big Playern
zu gefährlich geworden sind. Was am Ende zählt ist eben die Kohle - Punkt.
Aus diesen und ähnlichen Gründen haben sich Musiker auf der ganzen Welt mit der Frage beschäftigt, ob es nicht auch anders geht. Und auch wenn sich bisher noch keine allgemeingültige Lösung hat finden lassen, gab es doch seit dem Erstarken des Internets einige vielversprechende Ansätze. Einer davon war das sogenannte Netlabel. Ein Zusammenschluss verschiedener Musiker und Künstler zu einer gemeinsamen Plattform bzw Homepage, auf der die jeweiligen Releases heruntergeladen werden können. Kein bürokratischer Schnickschnack, überschaubare Ausgaben und globale Breitenwirkung, soweit man es schafft mit einigen kreativen Marketingspielereien auf sich aufmerksam zu machen.
Wolfwetz
- Reality Glitch (2018)
Die Idee hinter Labor L'art
2004 wurde das österreichische Electronic-Netlabel Laridae
gegründet, dessen Releases samt und sonders unter Creative Commons fielen, sprich: Das auf eine Zusammenarbeit mit der AKM verzichtete. Die Beteiligten handelten aus der Leidenschaft heraus und verdienten höchstens mit Auftritten etwas dazu, wurden aber schnell zu Legenden der österreichischen Electronic-Szene.
Sie inspirierten das 10 Jahre später gegründete Netlabel Labor L'art des salzburger Kunstkollektivs Bureau du Grand Mot. Dieses hatte von Laridae und seinen Interpreten aus der ganzen Welt gelernt, und beschlossen das Konzept der Debürokratisierung noch einen Schritt weiter zu gehen. Alles was sie brauchten war eine Homepage und URL, beides finanziert vom Verein mosaik, der sich ebenfalls aus dem Bureau du Grand Mot formte. Die eigentlichen Releases liegen auf den Bandcamp-Seiten der jeweiligen Interpreten, die lediglich auf Labor L'art eingebettet sind. Eine einfache, unspektakuläre, aber geniale Lösung die viele Vorteile mit sich bringt.
- Die Interpreten haben jederzeit Zugang auf ihre eigenen Werke und können sie gegebenenfalls noch einmal verändern, was prozessorientiertes und experimentelles Arbeiten ermöglicht. Mit anderen Worten: Die Musiker vertrauen ihre Werke nicht wie sonst üblich dem Label an, um daraus ein Produkt zu machen. Das Werk bleibt ein Werk!
- Statt ein Album auf einen Schlag zu veräußern, kann sein Inhalt nun auch peu à peu herausgebracht werden. Zum Beispiel das erste Drittel im März, das Zweite im April, das Dritte im Mai... Was den großen Vorteil hat, dass die Aufmerksamkeit auf das Werk länger anhält. Dadurch ergeben sich aber auch narrative Möglichkeiten, die es ermöglichen die Hörer auch auf einer persönlichen Ebene abzuholen.
- Obwohl die Releases auf Labor L'art für gewöhnlich frei erhältlich sind, können die einzelnen Interpreten auch Geld dafür verlangen. Dieses geht direkt an sie, nicht das Label, wenn man von den 15 Prozent absieht, die Bandcamp einstreicht, um werbefrei zu bleiben. Dafür fallen viele viele Kosten weg die bei einem normalen Label hinzu kämen. (Theoretisch brächte das auch steuerliche Vorteile: Kunst wird für gewöhnlich mit 10 % besteuert, außer bei Musikern die Platten verkaufen, da hier auch eine Firma, das Label mitmischt. Wenn alles direkt an die Musiker geht, wäre das nicht der Fall. Allerdings wurde dieses Vorgehen noch nicht erprobt!)
- Bandcamp stellt individuelle Download-Codes zur Verfügung, die im Grunde auf alles Mögliche aufgedruckt werden können. Mit anderen Worten: Artwork muss sich nicht mehr nur auf seine Rolle als Verpackungsmaterial für einen physischen Tonträger reduzieren lassen, sondern kann selbst einfach Kunst sein und/oder ein Schlüssel zum dazugehörigen Release. Ein Experiment das schon einmal mit großem Erfolg von der Band Heidelbert
versucht wurde, die ihre erste Single quasi als Postkarte veräußerten.
- Sollte ein Interpret vorhaben sein Album aus dem Katalog zu nehmen und auf einem anderen Label neu zu veröffentlichen, ist dies auch jederzeit möglich. Es gibt keinen Vertrag, da ja alles Material bei den Interpreten selbst bleibt und das Label nichts an ihnen verdient, wodurch auch keine Forderungen an das Label selbst gestellt werden können.
Mehr dazu unter:
www.laborlart.at
#FEEDBACK

Der Text von "Nóttin talar" (Die Nacht spricht) drückt tiefe Traurigkeit und den Wunsch aus, in die Vergangenheit zurückzukehren. Bilder wie ein versteckter Pfad und ein grauer Spiegel deuten auf eine Innenschau und den Wunsch hin, zur Vergangenheit zurückzukehren. Der Sänger spricht von Erinnerungen, die wie Glut brennen, und unausgesprochenen Worten, und fragt sich, ob Antworten in einer anderen Zeit existieren. Es gibt ein starkes Gefühl der Schuld und den Wunsch, vergangene Fehler ungeschehen zu machen, wobei wiederholt darum gebeten wird, Í GEGNUM TÍMANN (durch die Zeit) zurückzukehren, um Dinge zu reparieren. Das Vergehen der Zeit wird durch fallende Tage und stille Tränen dargestellt, was hervorhebt, dass die Zeit nicht umgekehrt werden kann. Der Sänger träumt von einer zweiten Chance, präsent und liebevoll zu sein. Auch wenn eine Rückkehr unmöglich sein mag und der Schmerz persönlich ist, bleibt die Hoffnung, Dinge richtigzustellen. Das Musikvideo, das drei junge Männer beim Spaß zeigt, steht im Kontrast zu diesen traurigen Texten. Es scheint hervorzuheben, wie schnell die Jugend und diese unbeschwerten Zeiten vergehen und wie Handlungen in der Jugend später zu Bedauern führen können. Die Freude im Video repräsentiert eine Zeit, die nicht zurückgebracht werden kann, und die Texte deuten darauf hin, dass die jungen Männer eines Tages zurückblicken und sich wünschen könnten, sie hätten Dinge anders gemacht. Der Unterschied zwischen den fröhlichen Bildern und den traurigen Worten betont, wie die Zeit vergeht und wie unsere vergangenen Handlungen uns belasten können. Hier gibt es mehr Informationen zum Musikprojekt: https://www.kollektiv-magazin.com/ai-musikprojekt-dominion-protocol

Eigentlich stehen sie in der zweiten Reihe und halten den großen Stars des Landes den Rücken frei. Doch wenn Thommy Pilat und David Pross gemeinsam die Bühne betreten, gehört das Rampenlicht ganz allein ihnen – und ihrem unnachahmlichen Mix aus virtuoser Musik und Wiener Kleinkunst. Wien, 15. Bezirk. Das „Tschocherl“ ist eigentlich ein Ort für die kleinen Momente, doch an diesem Abend wirkt es fast zu klein für die geballte Präsenz, die da auf der Bühne steht. Thommy Pilat und David Pross haben geladen. Wer die beiden kennt, weiß: Hier geht es nicht nur um Noten, hier geht es um das „G’fühl“. Die Edel-Dienstleister treten vor Normalerweise sind die beiden das, was man in der Branche respektvoll „Jobmusiker“ nennt. Hochkarätige Profis, die gebucht werden, wenn der Sound perfekt sitzen muss. Ob als Begleitmusiker für namhafte Austropop-Größen oder in diversen Studioformationen – Pilat und Pross haben in der heimischen Szene längst ihre Spuren hinterlassen. Doch das Duo-Projekt ist ihr Herzstück, ihre kreative Spielwiese. Hier erfüllen sie sich den Traum, die großen Gesten der Popwelt gegen die Intimität der Kleinkunst einzutauschen. Das Ergebnis ist eine Melange aus anspruchsvollem Repertoire und einem Unterhaltungswert, der oft an klassisches Kabarett grenzt. Zwei Originale: Wer sind die Männer hinter den Instrumenten? Thommy Pilat ist in Wien kein Unbekannter. Als Sänger und Gitarrist steht er normalerweise seiner eigenen Formation „Thommy Pilat & Band – Die JÄGER“ vor. Er beherrscht die Kunst, Gefühle in seine Stimme zu legen, ohne dabei ins Kitschige abzugleiten. Im Duo mit Pross übernimmt er den Part des charmanten Erzählers, dessen Gitarrenspiel so präzise wie gefühlvoll ist. David Pross hingegen ist das musikalische Schweizer Taschenmesser des Duos. „Der David kann leider jedes Instrument spielen“, scherzt ein Gast im Video – und trifft damit den Kern. Ob am Bass, am Klavier oder mit seiner markanten Stimme, die jedes Cover zu einem eigenen Song macht: Pross ist ein Vollblutmusiker durch und durch. Seine Vita ist geprägt von der Zusammenarbeit mit zahlreichen Künstlern der Wiener Szene, wobei er oft auch als Produzent und Arrangeur im Hintergrund die Fäden zieht. „Die zwei Bladen“ und der Asterix-Faktor Was den Abend im Tschocherl so besonders macht, ist die Authentizität. Die beiden nehmen sich selbst nicht zu ernst. Mit einer ordentlichen Portion Wiener Schmäh wird über das eigene Gewicht gefrotzelt – ein Insider-Witz, der sogar zu dem (inoffiziellen) Arbeitstitel „Die zwei Bladen“ führte, initiiert von ihren eigenen Partnerinnen. Vergleiche mit Asterix und Obelix oder einem „Brad Pitt in Troja“ (mit einem Augenzwinkern) fliegen durch den Raum. Es ist diese Mischung aus Selbstironie und musikalischer Perfektion, die das Publikum abholt. Man hört Klassiker wie „Ohne Dich schlaf ich heut Nacht nicht ein“ oder „Marlene“, doch in der Interpretation von Pilat & Pross klingen sie nicht nach Kopie, sondern nach einer ehrlichen Hommage. Ein Abend für die Seele Das Fazit der Zuschauer ist eindeutig: „Sensationell“, „authentisch“, „einfach nur geil“. Es ist die Chemie zwischen den beiden „Männern im besten Alter“, wie es ein Fan ausdrückt, die den Funken überspringen lässt. Wenn sie am Ende des Abends „Free Falling“ anstimmen, dann glaubt man ihnen das aufs Wort. Pilat & Pross beweisen, dass man nicht immer die großen Stadien braucht, um große Kunst zu machen. Manchmal reicht ein kleines Lokal im 15. Bezirk, zwei Instrumente und zwei Musiker, die genau wissen, wer sie sind – und was sie können.