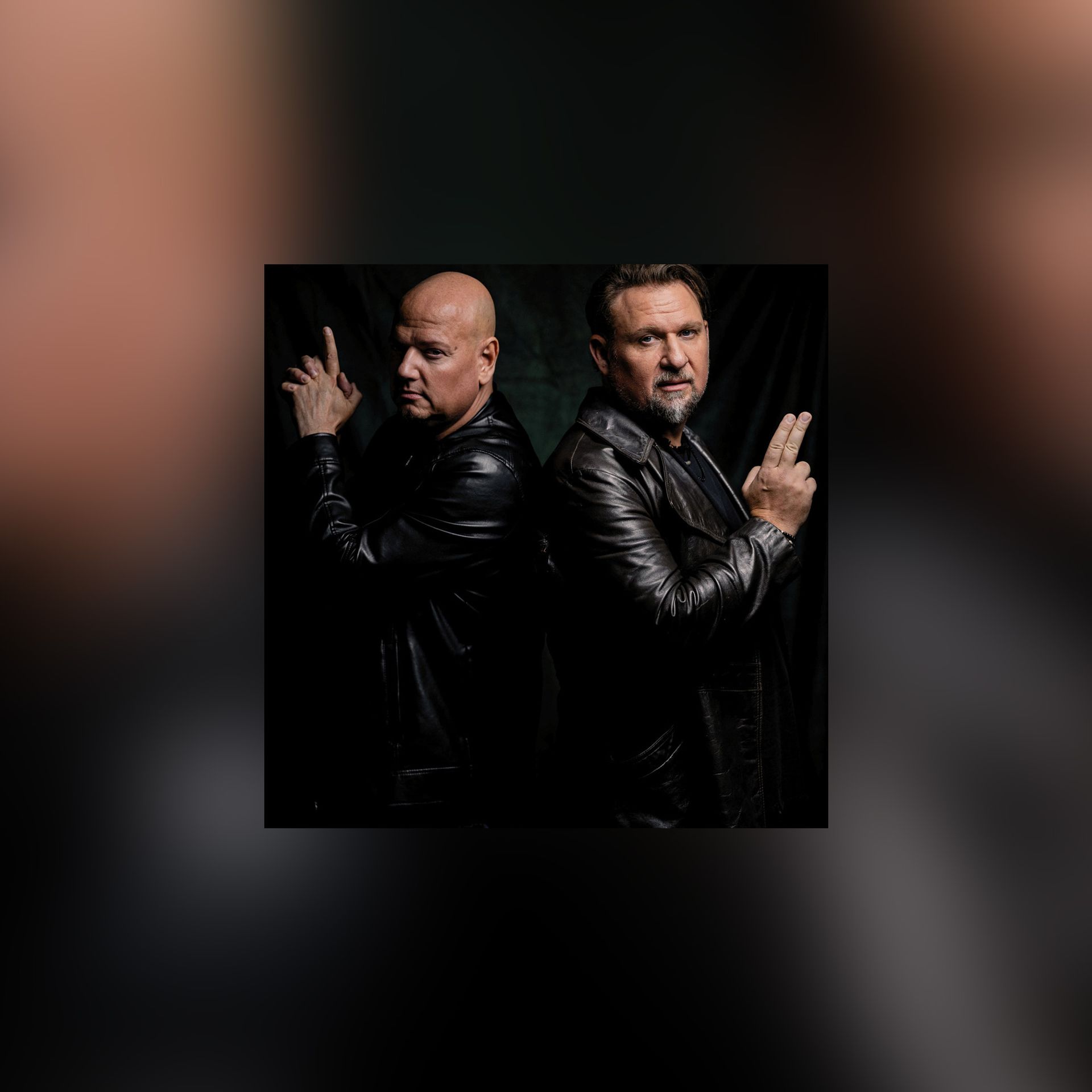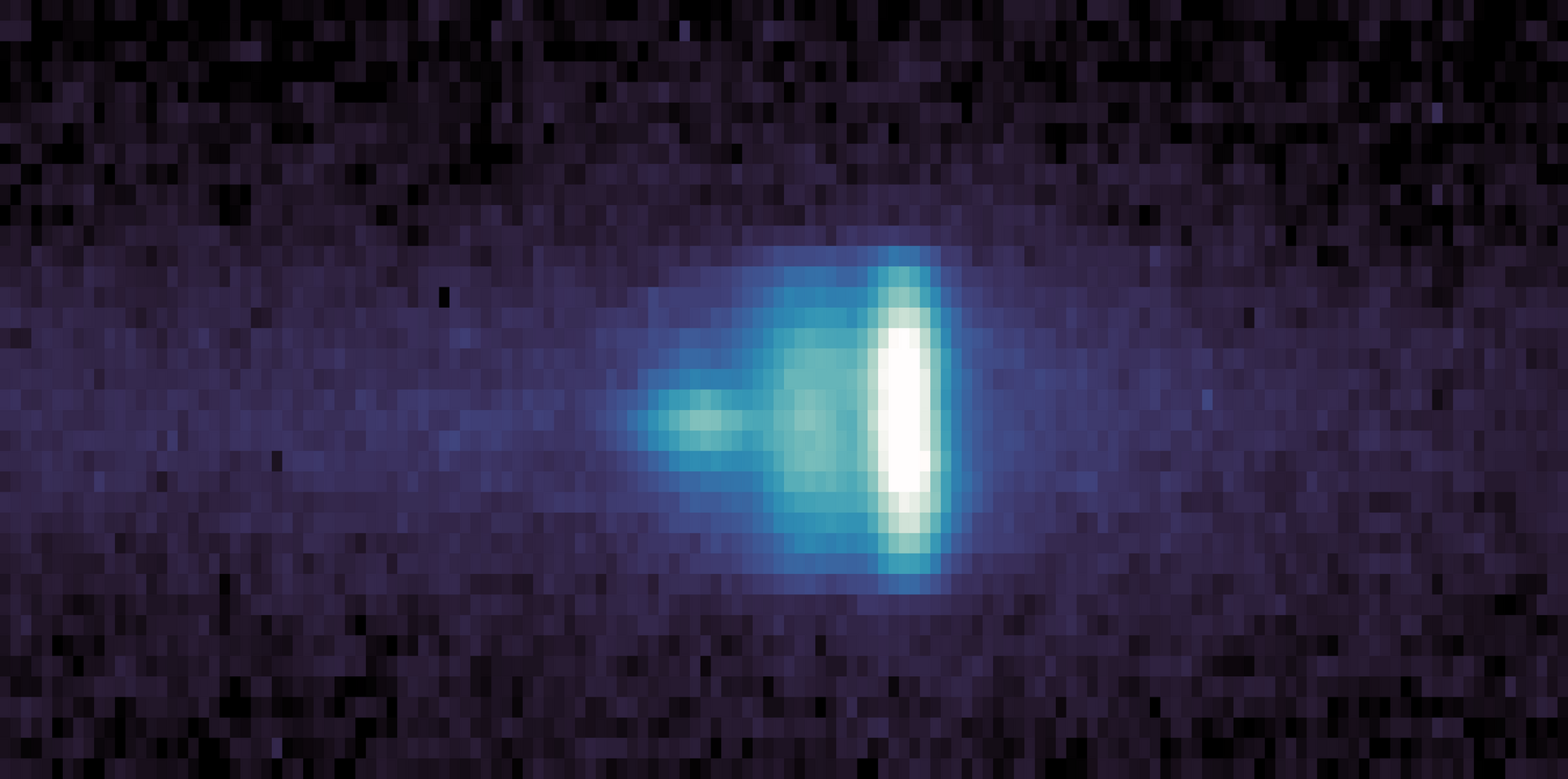DARK ODDITIES #5 (MUSIKVIDEO EDITION)

Source: "Monkey Drummer" (2001) by Aphex Twin + Chris Cunningham.
Prolog
Als jemand der in den 1980ern und 90ern aufwuchs kann ich mit Fug und Recht behaupten einige wirklich verstörende Musikvideos gesehen zu haben. Es war die Zeit als Sender wie MTV und VIVA noch vornehmlich Musik spielten, statt mit diversen TV-Formaten herum zu experimentieren. Da musste man sich als Musiker schon was einfallen lassen, um die Aufmerksamkeit des Publikums auf sich zu lenken. Da war viel Kreatives dabei, aber auch unfreiwillig Komisches, Bizarres und Gruseliges. Heutzutage glauben viele die perverse Schaulust ihrer Fans befriedigen zu müssen, mit blutrünstigen, gewalttätigen und übersexualisierten Szenen. Hängen bleiben aber die wirklichen Kunstwerke, mit viel Liebe zum Detail und jene Videos mit einer tragischen Hintergrundgeschichte...
Aphex Twin - Rubber Johnny (2005)
Richard D. James alias Aphex Twin ist ein britisch-irischer Musiker, DJ und Betreiber des Labels Rephlex Records. Er gilt als Ikone des Intelligent Dance Music-Genres (kurz IDM) - er selbst verwendet den weniger wertenden Begriff Braindance. Aphex Twin galt vor allem in den späten 90ern und Anfang der 2000er als ein Visionär der elektronischen Musik, gestützt vor allem durch seine Musikvideos die in Zusammenarbeit mit Video artist Chris Cunningham entstanden. Cunningham ist für seine experimentierfreudigen Arbeiten bekannt wie ein bunter Hund, er hat auch mit Interpreten wie Autechre, Björk, Madonna, Portishead, Squarepusher uva zusammengearbeitet.
2005 brachten die Beiden das verstörende Musikvideo Rubber Johnny heraus, das großteils in Infrarot gedreht wurde. Johnny (gespielt von Cunningham) ist ein in Dunkelheit gehaltener "Freak" im Rollstuhl, der zu unglaublich flinken, die Gesetze der Physik brechenden Verrenkungen fähig ist, dieweil er zu einer Version von Aphex Twin's "Afx237 v.7" tanzt. Mit ihm im Dunkeln ist ein Chihuahua, dessen riesige Augen dem Schauspiel ein zusätzlich gruseliges Element verleihen.
Soul Asylum - Runaway Train (1993)
Runaway Train war eine 1993 herausgebrachte Powerballade der amerikanischen Rockband Soul Asylum, die vor allem durch ihre Musikvideos (es gab internationale Versionen) bekannt wurde, in denen auf vermisste Kinder und Teenager aufmerksam gemacht wurde. Die Videos wurden vom jüdisch-stämmigen Engländer Tony Kaye produziert, dem späteren Regisseur des Filmklassikers American History X, und wurden wegen ihrer wichtigen Message sehr häufig auf MTV und VH1 gespielt.
Durch die großangelegte Kampagne konnten 26 vermisste Kinder wiedergefunden werden. Etliche Fälle endeten aber in einer Tragödie: Wie sich herausstellte waren manche tatsächlich davongelaufen, um den prekären Verhältnissen in ihrem Elternhaus zu entkommen. Andernorts wurden Leichen gefunden und Eltern verhaftet, die für ihre Ermordung verantwortlich waren. Viele der in Australien gezeigten Kinder entpuppten sich als Opfer des Serienmörders Ivan Milat. Darüber hinaus blieben mindestens 9 Fälle bis zum heutigen Tag ungeklärt.
Falco - Jeanny (1985)
Wie schon erwähnt waren die 1980er nicht arm an verstörenden Musikvideos, einige Skandale waren aber auch dabei: Zunehmende Sexualisierung, heikle Themen und verstörende Inhalte brachten die Stimmung zum kochen. In Deutschland setzte sich die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften für etliche Sendeverbote ein und auch MTV boykottiere eine Menge Musikvideos, was dem Sender viel Kritik einbrachte. Als einer der größten Skandale im deutschsprachigen Raum gilt die 1985 erschienene Single Jeanny der österreichischen Poplegende Falco, die scheinbar aus der Sicht eines psychopathischen Mädchenmörders erzählt wurde. Das Video, mit seinen Anleihen an Filme wie "M", "Der dritte Mann" und "Psycho", unterstreicht dabei die zutiefst verstörenden Geschichte des Musikstücks. Viele Sender boykottierten "Jeanny" weil es angeblich Vergewaltigung und Gewalt an Frauen verherrliche, sogar Wetten dass-Legende Thomas Gottschalk zeigte sich empört.
Die Geschichte um Jeanny geht aber noch tiefer, entpuppt sich als viel subtiler und dramatischer als zuvor angenommen. Es deutet sich an, dass der von Falco gesprochene Mann unschuldig ist, Jeanny ihren Tod nur vorgetäuscht hat und es sich in Wahrheit um ein tragisches Liebeslied handelt. Tatsächlich wurde die Nummer 1986 mit Coming Home (Jeanny Part 2, ein Jahr danach), 1990 mit Bar Minor 7/11 (Jeanny Dry) und 2009 mit The Spirit Never Dies (Jeanny Final) fortgesetzt. 2000 kam zudem ein alternativer dritter Teil heraus, Where Are You Now (Jeanny Part 3). Dieser wurde allerdings ohne Erlaubnis der Rechteinhaber veröffentlicht. Regie für das Musikvideo führte der Australier Russell Mulcahy. Zurzeit befindet sich eine Umsetzung als Fernseh-Thriller mit Manuel Rubey in Arbeit.
David Bowie - Lazarus (2015)
18 Monate vor seinem Tod wurde David Bowie mit Leberkrebs diagnostiziert. Er verschwieg dies gegenüber der Öffentlichkeit und widmete sich stattdessen seinem letzten großen Album Darkstar. Noch während das Musikvideo zu Lazarus, der letzten zu Bowie's Lebzeiten veröffentlichten Single gedreht wurde, teilten ihm die Ärzte mit, dass es keine Heilungschancen mehr gab und seine Behandlung eingestellt würde. Laut seinem langjährigen Producer Tony Visconti sollte Lazarus ein Selbst-Epitaph sein, ein letzter Kommentar zu Bowie's nahendem Ende. Gedreht wurde in New York, Regisseur war der Schwede Johan Renck, der später auch an der Serie Chernobyl arbeiten sollte. Das Video kam am 7. Januar 2016 heraus, drei Tage vor David Bowie starb.
#FEEDBACK