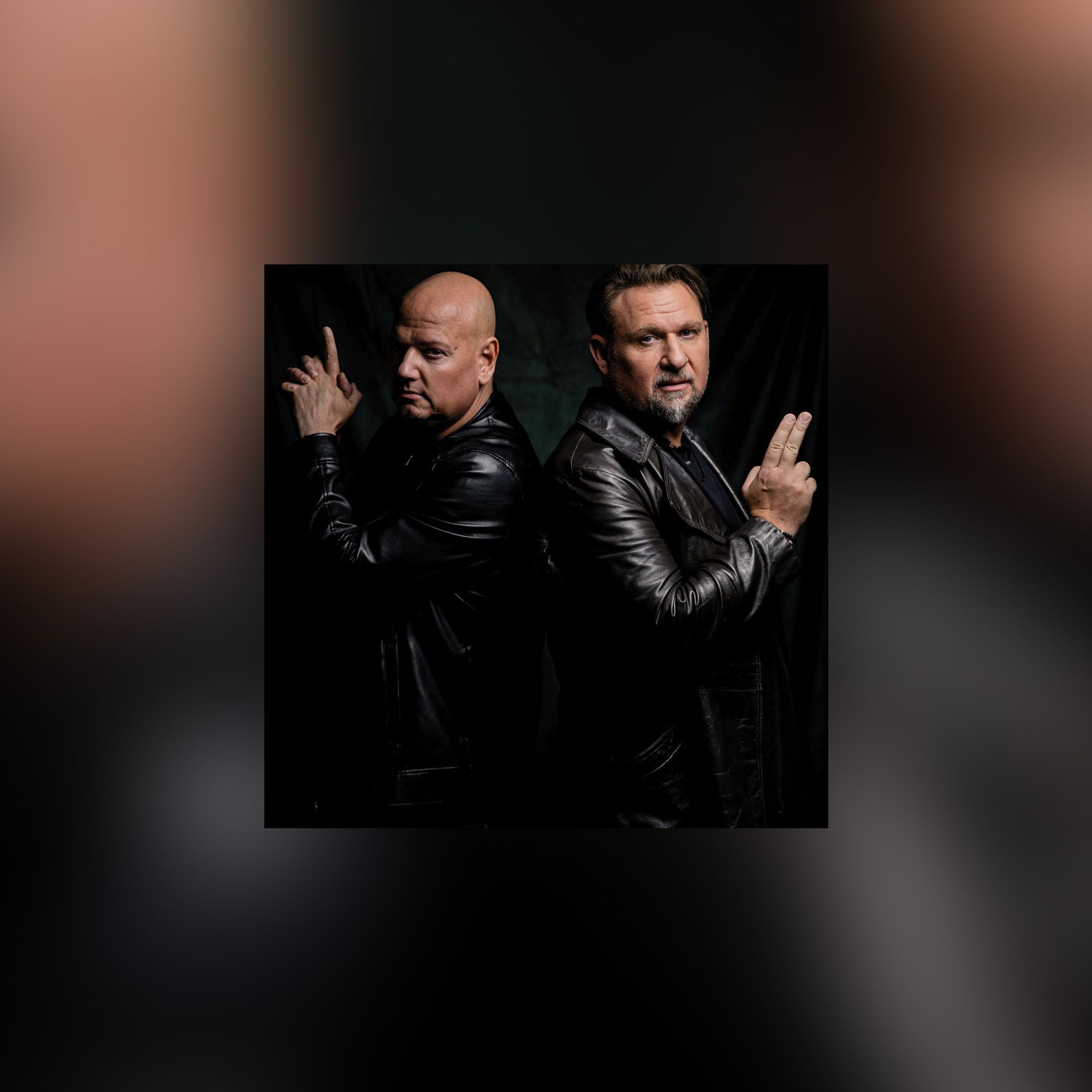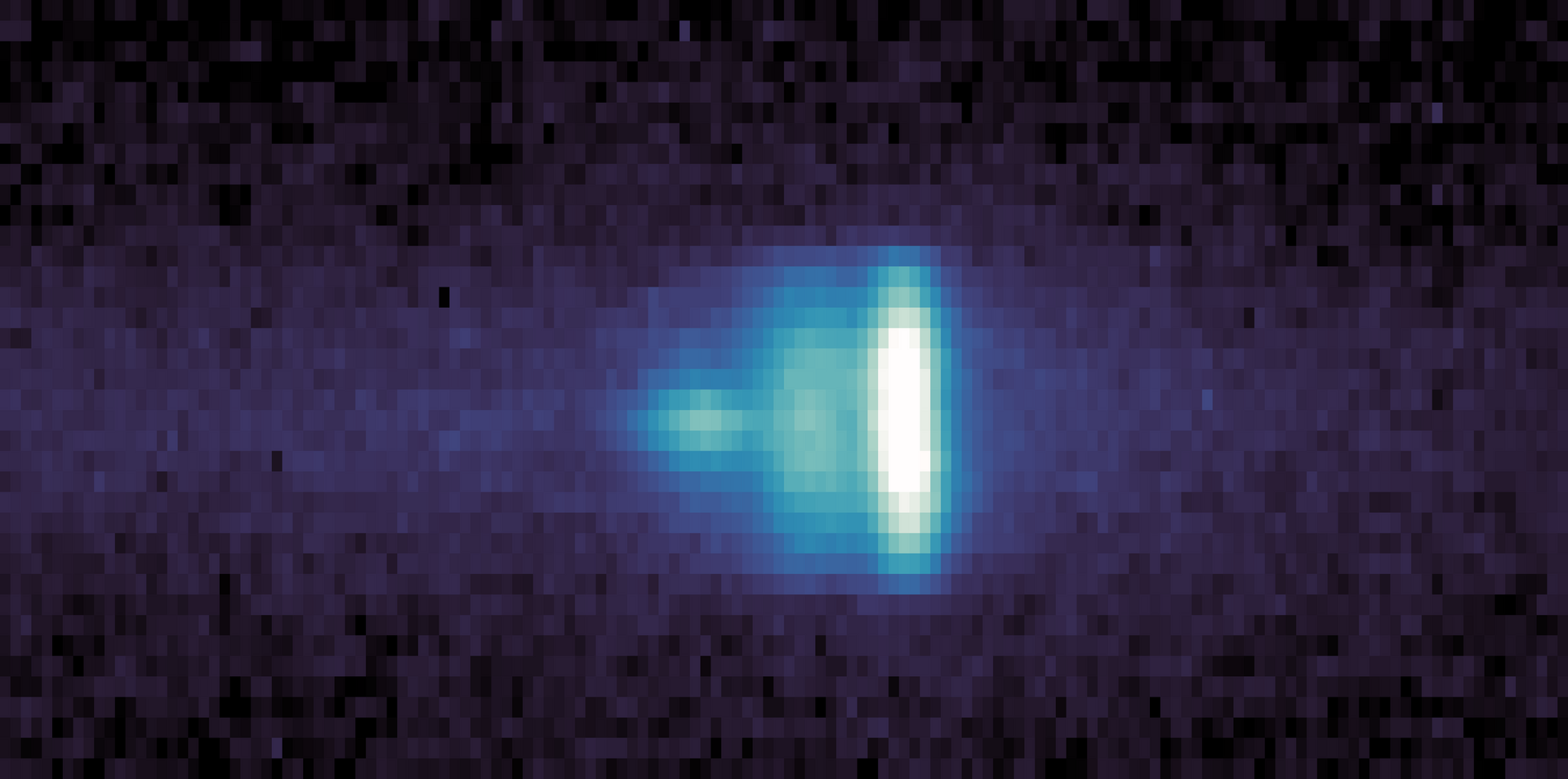DARK ODDITIES #34 (HUMAN STUPIDITY EDITION)
Disclaimer: Die hier gezeigten Beiträge enthalten zum Teil erschreckendes, verstörendes Material, sowie schnelle Lichtwechsel die möglicherweise epileptische Anfälle auslösen können.

Photo (C) Thom Sheridan
Prolog
Wir sind in den vergangenen Jahren einigen wirklich dunklen und verstörenden Dingen auf den Grund gegangen. Haben über Monster, Verschwörungen, Flüche, seltsame Krankheiten, bizarre Medienphänomene und vieles vieles mehr gesprochen. Vieles von dem was wir zur Sprache brachten lässt sich allerdings nicht auf unbekannte, wenn nicht gar übernatürliche Ursachen zurückführen, sondern auf die Abgründe die uns Menschen selbst zu eigen sind. Und auch dieses Mal wird davon die Rede sein! Wobei wir uns auf etwas fokussieren, das bisher kaum zur Sprache kam, dessen verheerende Wirkung uns in den vergangenen Jahren aber umso bewusster geworden ist: Die Dummheit des Menschen! Wieviele unnötige Katastrophen zustande gekommen sind, weil jemand eine Schnapsidee hatte oder einfach nicht richtig mitgedacht wurde, ist absolut furchteinflößend! Hier wieder vier Beispiele...
Die missglückte Walsprengung von 1970
Am 9. November 1970 wurde ein 14 m langer Pottwal an die Küste von Florence, Oregon gespült. Der 7,300 kg schwere Leichnam musste beseitigt werden, eine Verantwortung die der Oregon Highway Division zufiel, die nach Rücksprache mit der US Navy beschloss den Wal mit Dynamit in so kleine Teile zu sprengen, dass sie von den umliegenden Möwen leichter gefressen werden konnten. Der für die Sprengung verantwortliche Ingenieur George Thornton war sich selbst nicht sicher wieviel Dynamit sie für die Aktion brauchen würden. Er war selbst nur eingesprungen, weil sein Vorgesetzter jagen gegangen war. Ein zufällig anwesender Militär-Veteran mit Sprengerfahrung, warnte dass die Menge zu viel sein würde. Er wurde aber schlichtweg ignoriert. Die Detonation erfolgte am 12. November um 15:45 Uhr und wurde von einem Reporterteam von KATU-TV aus Portland festgehalten. Obwohl Thornton noch Jahre später von einer erfolgreichen Sprengung sprach, sind die Konsequenzen seiner Tat nicht zu leugnen. Große Klumpen des Kadavers regneten nicht nur auf die umliegenden Passanten, sondern krachten auch auf weiter entfernte Gebäude und Parkplätze, wo sie für einen nicht unbedeutenden Sachschaden sorgten. Die Möwen, die sich um die Überreste kümmern sollten, suchten aufgeschreckt von der Explosion das Weite.
Crash at Crush (1896)
Am 15. September 1896 fand südlich von West bei McLennan County, Texas ein Publicity-Stunt mit verheerenden Folgen statt. William George Crush von Missouri-Kansas-Texas Railroad hatte die abenteuerliche Geschäftsidee zwei ausgemusterte Dampflokomotiven mit höchstmöglicher Geschwindigkeit ineinander krachen zu lassen und mit dem Event Schaulustige anzulocken, die nicht nur Eintritt bezahlen, sondern für die Anreise auch Tickets bei seiner Bahngesellschaft kaufen würden. Nahe der ausgewählten Bahnstrecke wurde eine temporäre Zeltstadt aufgebaut, die man nach Crush benannte. 30.000 – 40.000 Zuschauer reisten an, um sich den "Crash at Crush" nicht entgehen zu lassen. Die Züge wurden vom Personal präpariert, das natürlich absprang ehe die Vehikel die erwarteten 70 km/h erreichten. Bis dahin lief alles nach Plan! Woran allerdings niemand gedacht hatte, war die auf den Zusammenprall folgenden Kesselexplosionen, die mehrere 100 Meter weit große Schrapnelle um sich schleuderten. 2 Zuschauer wurden tödlich getroffen, zahlreiche verletzt. Fotograf Jarvis „Joe“ Deane verlor ein Auge. Crush wurde gefeuert, nach Ausbleiben einer negativen Presse aber wieder eingestellt.
Fascination Horror erzählt...
Das Balloonfest 86-Desaster
Am 27. September 1986 nahm in Cleveland, Ohio eine Katastrophe ihren Lauf, die verhindert werden hätte könne, wenn jemand nur ein bisschen mitgedacht hätte. Die Nonprofit-Organisation United Way wollte zu Ehren ihres 150sten Jubiläums eine Fundraising-Aktion starten, mit der gleichzeitig auch einen Weltrekord gebrochen werden sollte. Man entschied sich für Luftballons, von denen freiwillige Helfer 1.5 Millionen unter einem großen Netz sammelten, die später auf einen Schlag freigelassen wurden. Die Aktion erwies sich nicht nur als dumm weil sie eine enorme Belastung für die Umwelt darstellte, eine Schlechtwetterfront drückte die Ballons auch noch nach unten, mitten in die Stadt, wo sie ein ungeheures Chaos erzeugten. Es gab einen Haufen Verkehrsunfälle. Der Burke Lakefront-Flughafen musste seinen Betrieb einstellen. Noch Tage später konnte man Ballons im nahegelegenen Lake Erie finden, selbst auf kanadischer Seite. Am Tragischsten war allerdings das Schicksal zweier Fischer, die ausgerechnet zu dieser Zeit auf See verloren gingen. Durch die Flut an im Wasser treibenden Ballonen sah sich die Küstenwache außerstande die Männer zu finden. Ihre Leichen wurden Tage später an Land gespült.
Lady White Rabbit berichtet Näheres...
Der zweite Demon Core-Vorfall (1946)
"Demon Core" war der Spitzname einer 89 mm großen Plutonium-Kugel die während des Zweiten Weltkriegs von den Amerikanern hergestellt wurde und als Bestandteil einer dritten Atombombe gegen Japan verwendet worden wäre, wozu es zum Glück nicht mehr kam. Japan kapitulierte am 15 August 1945 und der Demon Core lagerte für weitere Experimente im Los Alamos National Laboratory. Dennoch forderte er einige Menschenleben, zunächst das von Harry K. Daghlian Jr. der knapp eine Woche später einer tödlichen Strahlendosis ausgesetzt wurde, als er Barren aus Wolframcarbid um den Kern stapelte, um deren Wirkung als Neutronenreflektor zu testen, wobei er einer davon aus Versehen auf den Kern fallen ließ, der augenblicklich todbringende Ionenstrahlung abgab. Daghlian starb 25 Tage später an den Folgen.
Dieser erste Vorfall kann auf ein unglückliches Missgeschick zurückgeführt werden. Der zweite Vorfall zählt aber zu einen der dümmsten Missgriffe in der Geschichte der Wissenschaft. Wenige Monate nach Daghlian, am 21. Mai 1946 experimentierte der kanadische Physiker Louis Slotin mit sieben seiner Kollegen an dem Demon Core, den sie mit zwei Beryllium-Halbkugeln ummantelten um die Anfangsphase einer Kettenreaktion einzuleiten. Wichtig war, dass sich die Kugel unter keinen Umständen schloss, was normalerweise mittels eines mechanischen Schienensystems bewerkstelligt werden sollte. Slotin bediente sich stattdessen eines simplen Schraubenziehers als Trennstück und führte die obere Hälfte der Kugel per Hand über den Kern. Der Schraubenzieher rutschte jedoch ab, die Kugel schloss sich und es kam zu einer Kettenreaktion, bei der erneut eine hohe Strahlendosis freigesetzt wurde. Slotin starb neun Tage später an den Folgen, sein Assistent wurde schwer verletzt. Drei weitere Wissenschafter starben Jahre später an den Spätfolgen.
Die Geschichte um Slotin und den Demon Core wurde 1989 im Spielfilm "Die Schattenmacher" mit Paul Newman verarbeitet. Seit 2017 gelangt die Geschichte durch Youtube-Dokumentationen - wie diese von
Kyle Hill - und sehr makabre Memes wieder verstärkt in das Bewusstsein der breiten Bevölkerung.
#FEEDBACK