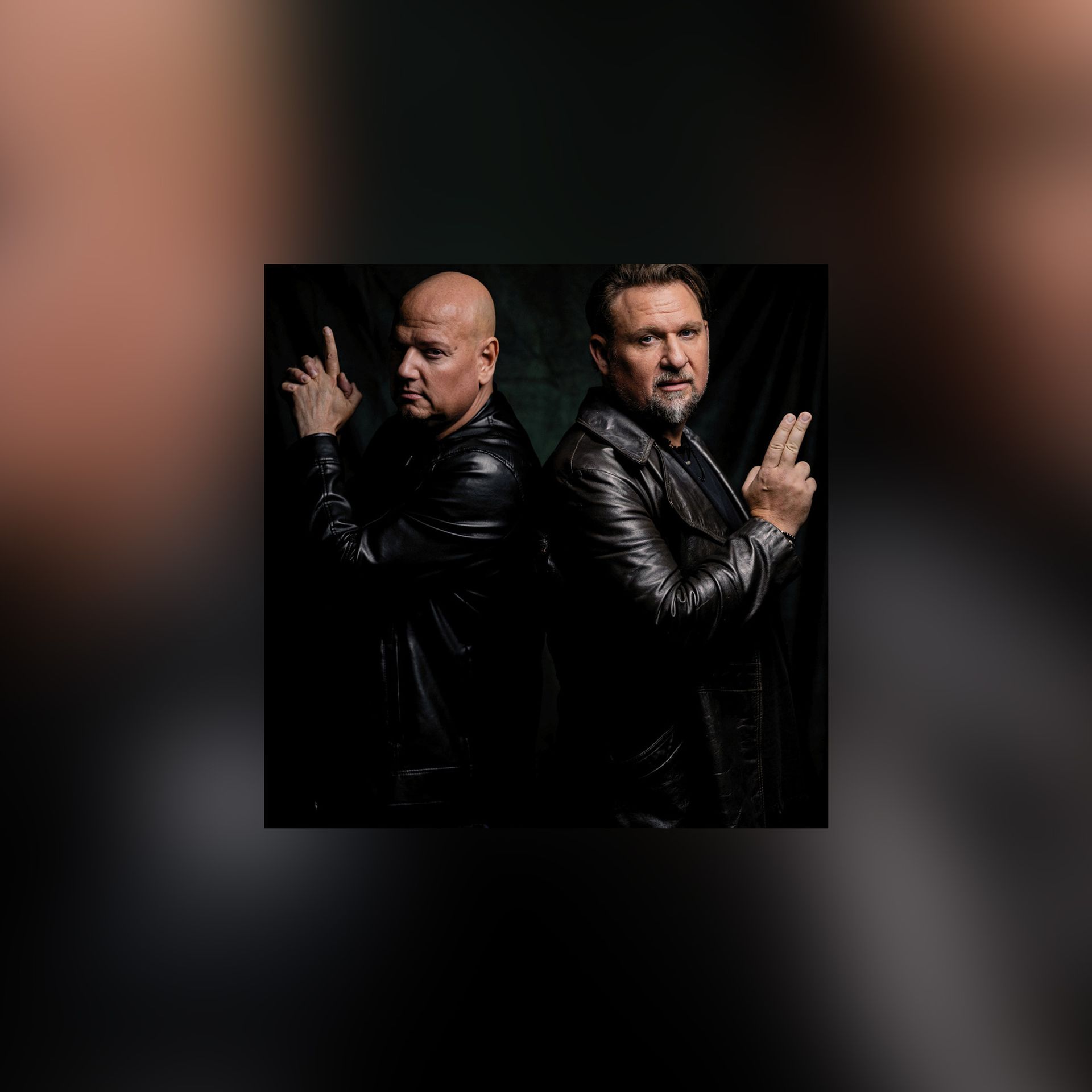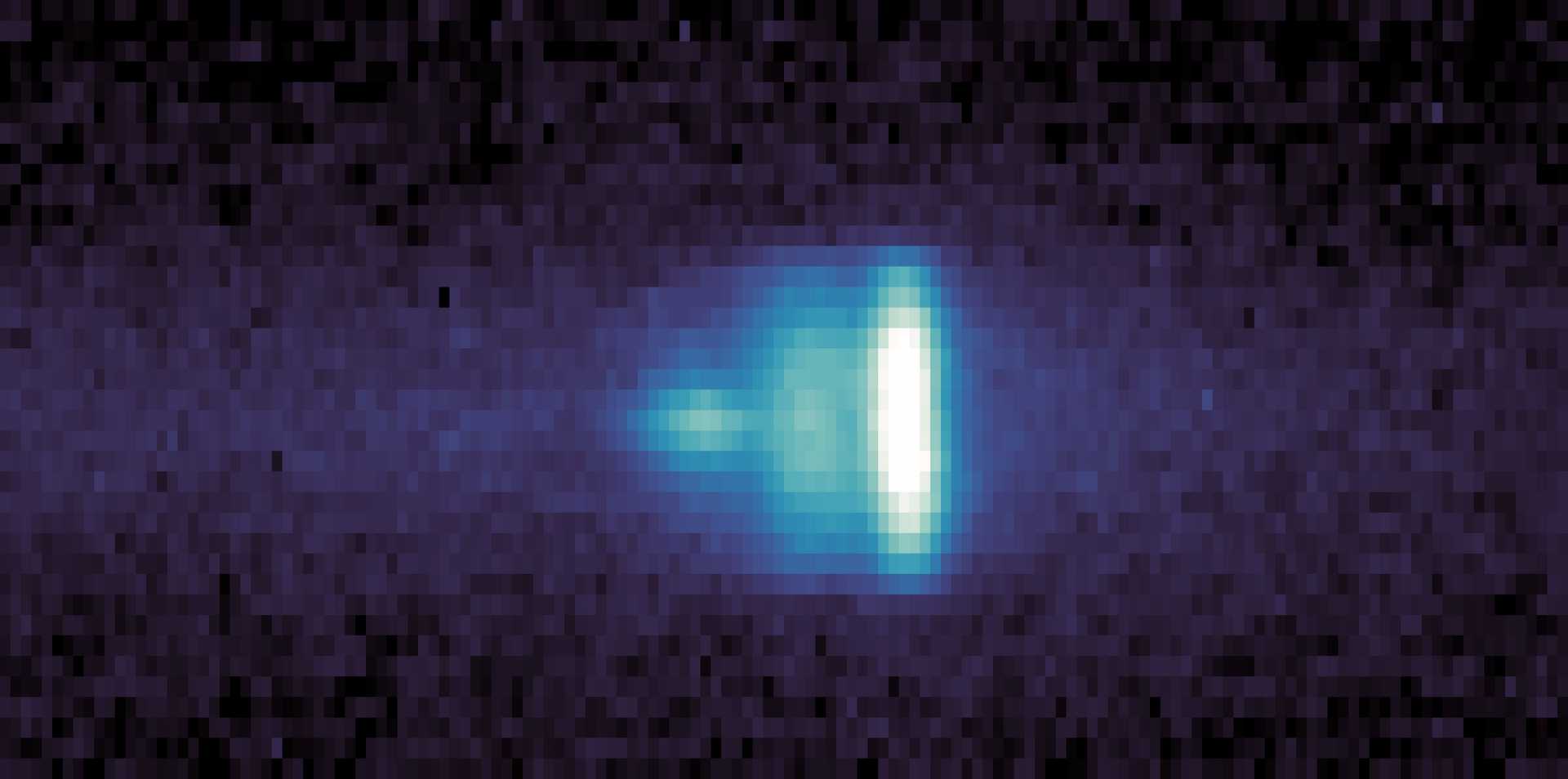DARK ODDITIES #32 (JAPAN EDITION)
Disclaimer: Die hier gezeigten Beiträge enthalten zum Teil erschreckendes, verstörendes Material, sowie schnelle Lichtwechsel die möglicherweise epileptische Anfälle auslösen können.

Prolog
Japan mag zwar nur eine kleiner Inselstaat im fernen Osten sein, doch sind seine reichhaltige Kultur, seine blühende Industrie und sein enormer Einfluss auf die Welt nicht wegzuleugnen. Auch in Sachen Horror hat Japan einiges zu bieten. Man denke nur an den ersten Godzilla von 1954, der in seiner Zerstörungskraft an die zu diesem Zeitpunkt kaum 10 Jahre zurückliegenden Schrecken von Hiroshima und Nagasaki erinnerte. Oder an den verstörenden Body Horror-Schocker
Tetsuo: The Iron Man (1989) in dem sich jemand Metallteile unters Fleisch rammt. An Klassiker wie
Ringu (1998) oder
Ju-On: The Grudge (2002), die bald so erfolgreich wurden, dass Remakes mit namhaften US-SchauspielerInnen produziert wurden. Ganz zu schweigen von den unzähligen Mangas und Animes, Büchern, Comiks, CDs und anderen Medien die sich mit dem Genre beschäftigen. All das ist natürlich nur die Spitze des Eisbergs, denn auch im wirklichen Leben spielen sich in und um Japan einige Dinge ab, die einen das Fürchten lehren. Dinge über die man selbst im aufgeschlossenen Japan nur unter vorgehaltener Hand spricht...
Japanische Mutproben
Wer kennt nicht die Urban Legend um den rachsüchtigen Geist der Bloody Mary? Einer entstellten und als Hexe verbrannten Frau, die angeblich heraufbeschwört werden kann, wenn man ihren Namen bei Kerzenlicht dreimal in einen Spiegel ruft. Variationen der Geschichte lassen sich auf der ganzen Welt finden, wie die Svarta Madame (Schwarze Madame) in Schweden oder Hanako-san in Japan. Gerade dort war man ganz besonders kreativ was solche Legenden betrifft und hat sich sowohl von der lokalen Folklore, als auch modernen Technologien inspirieren lassen. Jede ist mit einer rituellen Mutproben verbunden, die selbst dem gefestigtsten Charakter durch Mark und Bein geht. Blameitonjorge hat sich mit ReignBot, Dr. Creepen, Lets Read! und That Creepy Reading zusammen getan, um uns 10 düstere Beispiele vorzustellen...
Geisterschiffe
Jedes Jahr werden Dutzende Fischerboote an die Westküste Japans gespült, deren Besatzung entweder tot oder im Meer verschollen gegangen ist. In manchen Jahren übersteigt die Zahl der gefundenen Schiffe sogar den dreistelligen Bereich. Über die genaue Herkunft und Intention der Geisterschiffe lässt sich nur Vermutungen anstellen. So gibt es Theorien, dass es sich um verzweifelte Fischer aus Nordkorea handeln muss, die so weit vom Kurs abkommen, weil sie in den eigenen, von China überfischten Gewässern kaum Fang machen. Anderen Theorien zufolge könnte es sich auch um Flüchtlinge oder Spione handeln oder um illegale Fischer aus China selbst oder eine Art kranker, ausländischer Propaganda. Selbst übernatürliche Ursachen werden nicht ausgeschlossen. Was die Angelegenheit umso verstörender macht, ist dass die Todesursachen in vielen Fällen ungeklärt blieben. Die Leichen waren seltsam verstümmelt und die Schiffe hatten noch genügend Lebensmittel an Bord. Auch der Umstand, dass weder die Verstorbenen noch die Schiffe beansprucht werden, gibt Rätsel auf. Hier ein Beitrag von
Elder's Vault...
Das Monster mit 21 Gesichtern
Mitte der 1980er wurde Japan von einer bizarren, kriminellen Organisation in Atem gehalten, die sich selbst
Kaijin Nijūichi Mensō nannte, zu Deutsch:
Das Monster mit 21 Gesichtern. Im März 1984 entführten die Gruppe den Präsident des Lebensmittelherstellers Ezaki Glico und forderten ein Lösegeld von 1 Billion Yen, sowie 100 Kg Goldbarren. Bevor es zu einer Übergabe kommen konnte, gelang dem Entführten allerdings die Flucht aus einem abgelegenen Warenhaus in Osaka. Der eigentliche Terror begann damit aber erst, denn
Das Monster mit 21 Gesichtern verkündete nun Süßwaren von Ezaki Glico mit Zyankali versetzt zu haben. Das Unternehmen sah sich daraufhin gezwungen seine Produkte aus den Läden zu nehmen, was einen Schaden in Millionen-Höhe verursachte und etlichen Arbeitern den Job kostete. Auch das Konkurrenzunternehmen
Morinaga blieb von Drohungen nicht verschont. So plötzlich wie die Organisation in Erscheinung getreten war, verschwand sie auch wieder. Bis heute bleibt ungeklärt wer wirklich hinter dem
Monster mit 21 Gesichtern
steckte.
ReignBot geht ins Detail...
Der Chichijima-Vorfall
1944 wurden neun US-amerikanische Kampfpiloten während eines Angriffs auf die 700 Meilen südlich von Tokyo gelegene Insel Chichi Jima abgeschossen, von denen acht Mann in japanische Gefangenschaft gerieten. Was mit ihnen geschah blieb für viele Jahre ein dunkles Geheimnis, das nicht zuletzt deshalb aufgedeckt wurde, weil es sich bei dem neunten Mann der als Einziger entkam, um eine spätere Berühmtheit handelte. Die Kriegsgefangenen wurden unter grausamsten Umständen auf Chichi Jima festgehalten und misshandelt, bevor Vier von ihnen unter dem Befehl des zuständigen Offiziers Yoshio Tachibana geschlachtet, zubereitet und verspeist wurden. MrBallen erzählt die ganze markerschütternde Geschichte. WARNUNG: Nichts für schwache Nerven!
#FEEDBACK