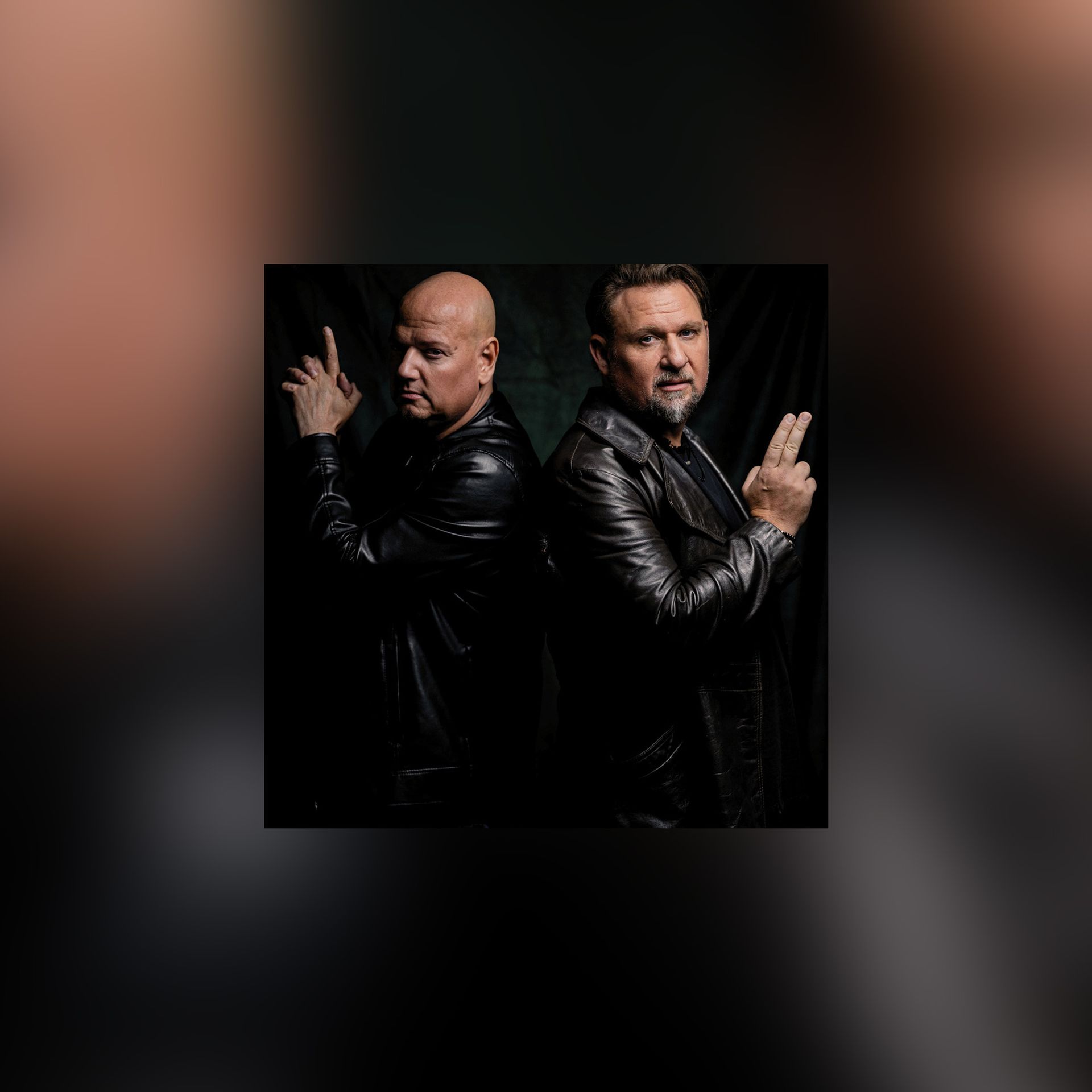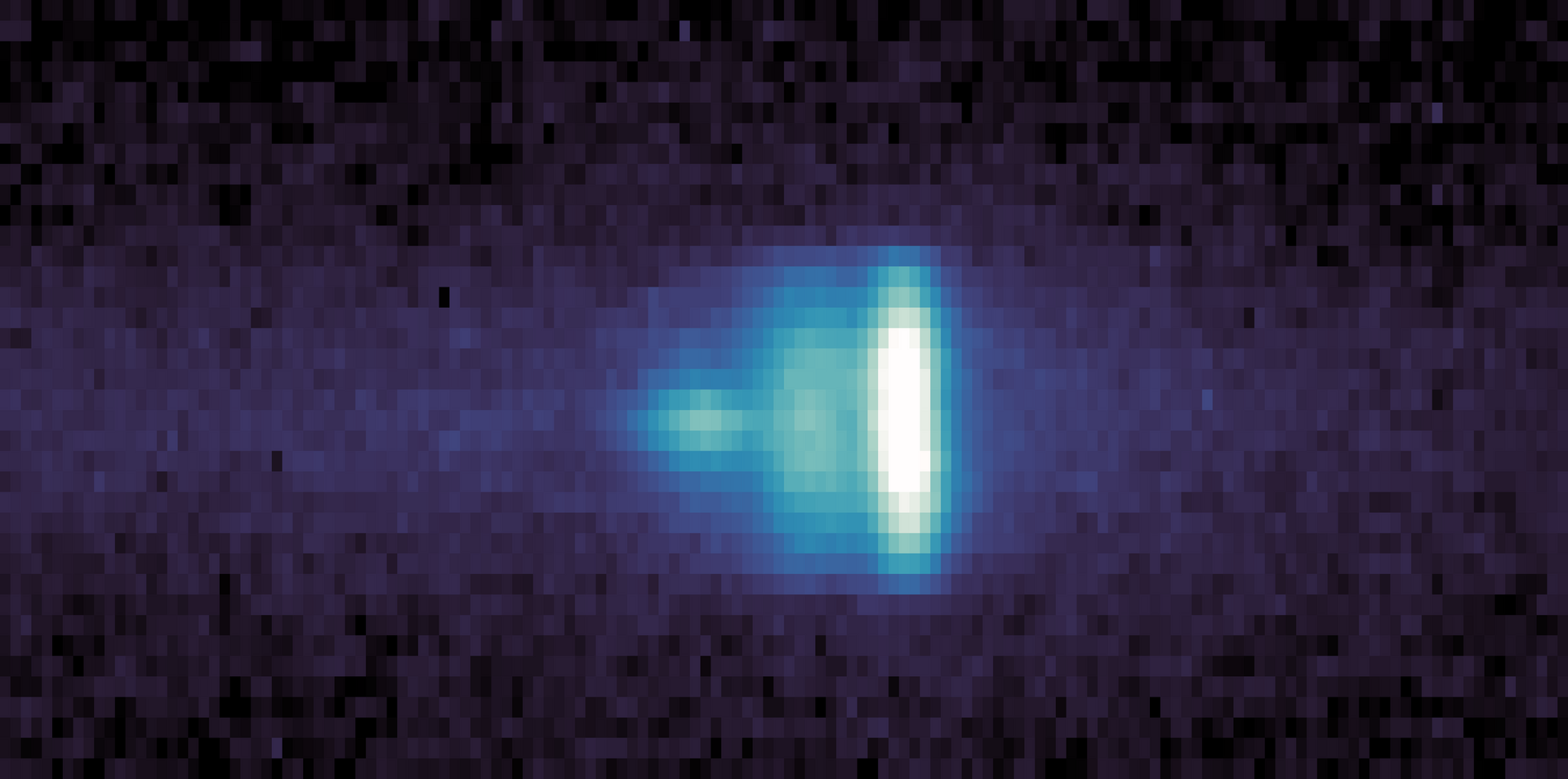DARK NOSTALGIA # 2
Dunkle Erinnerungen an das Fernsehen unserer Kindheit - nichts für schwache Nerven!

Willkommen zum zweiten Teil unserer Reihe über WTF-Momente der Fernsehgeschichte die uns als Kinder traumatisiert haben. Und mit "uns" meine ich die Kinder meiner Generation, die in den 80er und 90er Jahren aufwuchsen. Zeiten die zwar nicht unbedingt an die Grenzen des guten Geschmacks gingen, wie Produktionen a la Southpark oder Family Guy. Die aber noch mit echt verstörenden Inhalten zu glänzen wusste, die sich moderne Sender nicht mehr trauen zu senden. Zumindest zu Stunden da Kinder zusehen könnten! Tauchen wir also wieder ein in die Welt der Dunklen Nostalgie und lassen uns von ihr wieder zu Output inspirieren, der einem mit ehrlichem Schauer eine Gänsehaut über den Rücken jagt...
Sollte euch dazu auch noch etwas einfallen, kontaktiert uns unter: redaktion@kollektiv-magazin.com
ORF "Trailer"-Signation
In den 80er und 90er Jahren sendete der Österreichische Rundfunk eine Sendereihe die sich - innocent enough - mit "Tipps für Filmfreunde" beschäftigte. Zu Beginn der Sendung wurde diese Signation gespielt, unterstützt von "Bird's Lament" der Jazzgruppe Moondog aus dem Jahr 1969 - Jahre später auch bekannt geworden als Basis für "Get A Move On" von Mr Scruff. Sie beginnt relativ einfach mit der grafischen Darstellung einer Tonspur, die Farben rot, schwarz und weiß dominierend, was dem Ganzen schon einen leicht bedrohlichen Touch gibt, auch wenn man noch nicht mit den geschichtlichen Implikationen dieser Farbkombi vertraut ist. Es folgen einige bewegte Collagen von Filmschnipsel, die erst noch recht harmlos wirken, mit der Zeit aber einen unwirklichen, dunklen Ton annehmen: Vögelschwärme auf grünem Grund, verbrennendes Filmmaterial, mit Rotfilter versehene Negativaufnahmen... am Ende ein rotierender Frauenkopf, Hände im Dunkeln die in rascher Abfolge gestikulieren und schließlich ein Totenkopf. Alles in allem eine Signation die vor allem Kindern und Jugendlichen einen Schauer über den Rücken gejagt hat, die darüber stolperten, während sie auf die Ausstrahlung der Golden Girls warteten - warum auch immer der ORF glaubte sie so spät am Abend ausstrahlen zu müssen.
Rosa Elefanten
Ein Film der mir wie kein Anderer das Interesse am Zirkus verleidet hat war der Disney-Zeichentrickfilm Dumbo von 1941. Ein Film der heute vor allem für seine politisch-fragwürdigen Darstellungen in die Kritik genommen wird, aber auch auf herzzerreißende Weise Themen wie Mobbing und Ausgrenzung zum Thema macht. Darüber hinaus handelt es sich um einen sehr schönen, hervorragend produzierten Animations-Klassiker. Eine Szene die es jedoch fertig brachte mich und meine Geschwister in unseren Alpträumen zu verfolgen, war die Parade der Rosa Elefanten. Eine visuell eindrucksvolle, wenn auch psychodelisch-verstörende Szene die auf einer Halluzination des kleinen titelgebenden Helden Dumbo beruht, nachdem er aus Versehen Wasser aus einem Trog getrunken hat, in dem eine Flasche Champagner gefallen war. Der haarsträubende Horror dieses Segments beruht nicht nur auf den gezeigten Bildern, sondern auch dem unwirklichen Gesang, welcher in der deutschen Version besonders haarsträubend geraten ist.
Die grauen Herren
Ein weiterer Beitrag aus einer Verfilmung nach Michael Ende. 1986 kam die deutsch-italienische Produktion "Momo" ins Kino, um ein junges Waisenmädchen das sich gegen die sinistren Grauen Herren zur Wehr setzen muss, welche den Menschen ihre Zeit stehlen. Ebenjene zählen zu den größten Filmbösewichten der deutschen Filmgeschichte, die mit ihrem blassen, bürokratisch-anmutendem Erscheinungsbild in die 80er hineinpassen wie die Faust auf's Auge. Ihr Anführer wird gespielt von Armin Müller-Stahl, der eine brillante Performance abliefert. Für uns Kinder der 80er waren die Grauen Herren ein verstörender Blick in die dunkle Welt der Erwachsenen und auch wenn es uns noch nicht klar war, ein starkes politisches Statement.
The Undertaker
Anfang der 90er leisteten sich unsere Eltern endlich auch Kabelfernsehen, was es uns ermöglichte weit mehr zu sehen als die bisherigen 5 Sender FS 1, FS2, ARD, ZDF und BR. Hinzu kam unter anderem der Sportsender DSF mit seinem berühmten Werbespruch "Mittendrin statt nur dabei". Und mit ihm die Übertragungen der US-amerikanischen World Wrestling Federation, WWF (später: WWE), mit einigen der legendärsten Wrestlern aller Zeiten, wie Hulk Hogan, Bret the Hitman Hart, Sean Michaels... und unserem absoluten Liebling, dem dunklen, mysteriösen Undertaker. Was Wresting von anderen Sportarten unterscheidet sind seine Storylines, das Drama um die Charaktere, das in unseren jungen Köpfen umso mehr die Grenzen zwischen Realität und Fiktion verschwimmen ließ. Desto furchteinflößender und cool war der Undertaker, von dem es hieß er sei mit übernatürlichen Kräften ausgestattet und der sich in Momenten da es so aussah, als sei er bereits K.O. unerwartet wieder aufrichtete und seine Gegner mit kaltem Schrecken erfüllte. Wir hörten irgendwann auf damit uns Wresting anzusehen, aber der Undertaker alias Mark William Calaway legte noch bis 2020 eine beeindruckende Karriere hin,
Dagobert
Abseits der Fiktion sorgte auch die Medienberichterstattung gelegentlich für verstörenden Output. Zwischen 1988 - 94 trieb der mysteriöse Verbrecher Arno Funke sein Unwesen in Deutschland, dem die Presse den Namen "Dagobert" gegeben hatte. Er verübte Bombenanschläge in mehreren Kaufhäusern in ganz Deutschland und erpresste die Betreiber um enorme Geldsummen. Dabei gelang es ihm stets mit großem Geschick und Einfallsreichtum die Polizei an der Nase herumzuführen. Dies brachte ihm zwar große Sympathien in der Öffentlichkeit, die Ungewissheit wann und wo er als nächstes zuschlagen könnte hinterließ allerdings auch einen bitteren Beigeschmack. Für uns Kinder kam er einem kriminellen Supergenie gleich, das uns ein bisschen Angst machte.
Funke wurde schließlich im Frühjahr 1994 gefasst, doch im Jahr 2000 bereits wegen guter Führung wieder freigelassen. Wie sich herausstellte war er gar kein so schlechter Mensch: Er hatte bei seinen Anschlägen stets darauf geachtet, dass niemand verletzt wurde, was ihm leider nicht immer gelang. Auch litt er seinerzeit an einer schweren Depression, der er mit seinen abenteuerlichen Aktionen Herr werden wollte. Heute arbeitet der hochbegabte Berliner als Grafiker und Autor, tritt gelegentlich im Fernsehen auf und stand sogar schon mit den überlebenden Mitgliedern der Ton Steine Scherben auf der Bühne.
#FEEDBACK