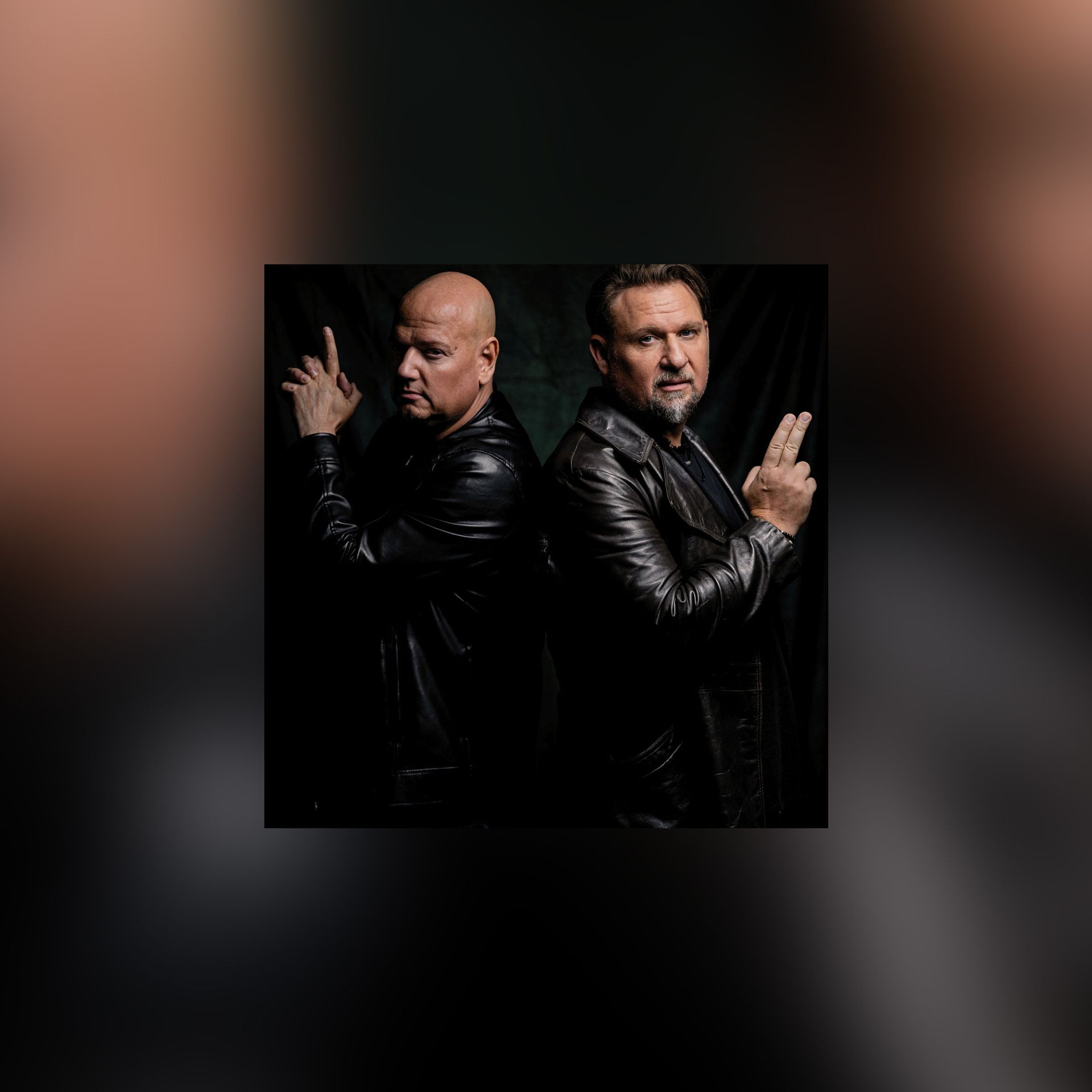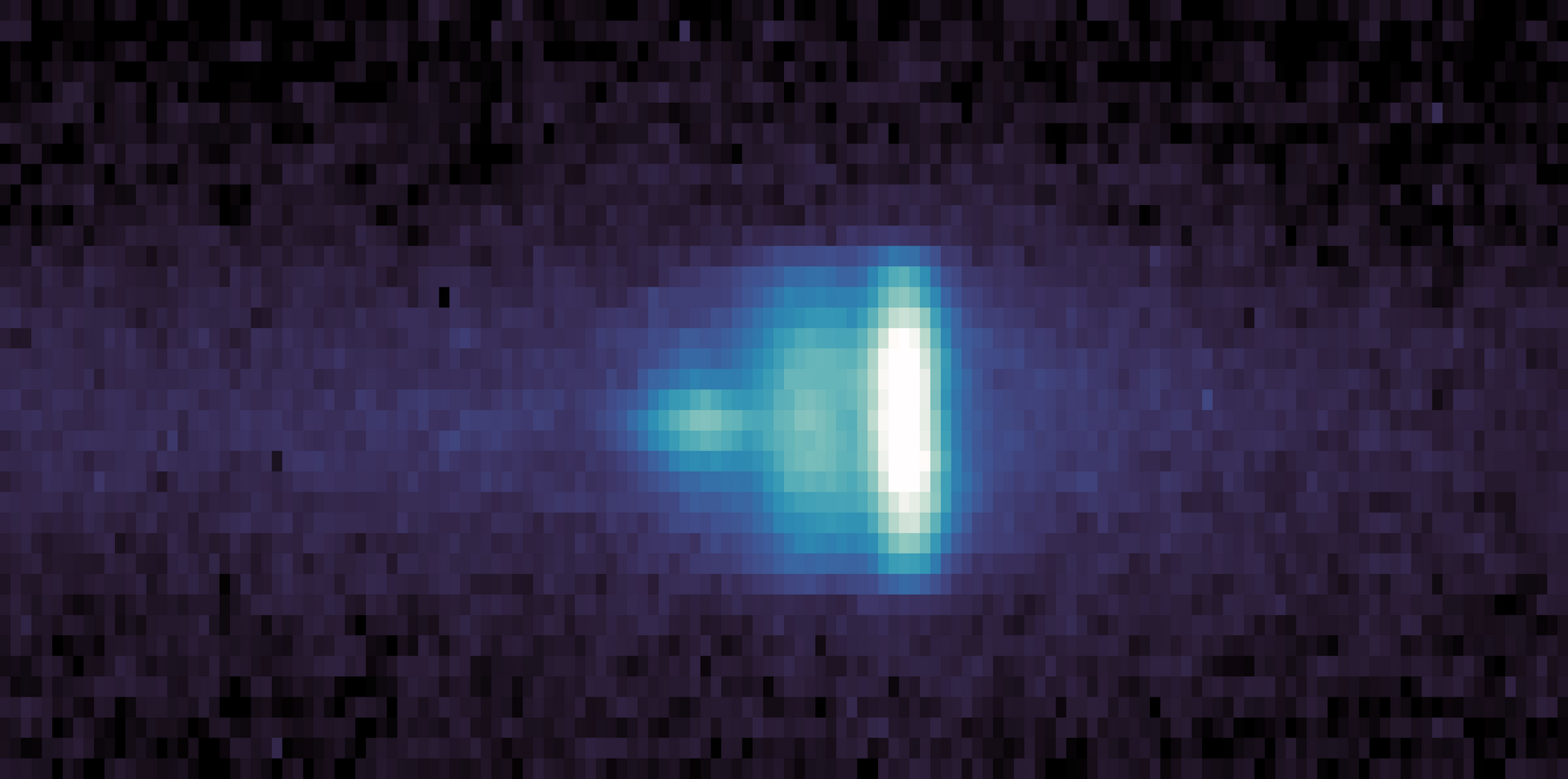DIE GESCHICHTE DES SCHLAGERS (1)

Source: Henri de Toulouse-Lautrec - La Danse au Moulin-Rouge
Prolog
Vor einiger Zeit, nach den Aufnahmen des Podcasts mit Norbert Frischauf (siehe
hier) saßen Manuel Waldner und ich noch eine gute Weile zusammen und redeten über Dieses & Jenes. Irgendwann kam auch die Sprache auf das Thema Musik, insbesondere die Ähnlichkeiten mancher Popnummern mit regionaler Schlagermusik. Übersetzte man nämlich so manches Lied ins Deutsche, hätte man im Grunde denselben schmalzigen Kitsch. Soweit die Theorie! Schließlich bat mich Manuel darüber einen Artikel zu schreiben. Ich sah ihn an als hätte er den Verstand verloren. Meinte er das ernst? Ich war ja offen für viele, zum Teil hochobskure Musikrichtungen. Aber Schlager?
Je länger ich in den kommenden Tagen über die Idee nachdachte, desto interessanter erschienen mir einige der damit verbundenen Aspekte. Was macht Schlager für Viele so reizvoll und für Andere unerträglich? Wo liegen die Wurzeln, was sind die Einflüsse? Und was kann man daraus lernen? Also gut! Meinetwegen! Bevor ich aber auch nur ein Viertel des Artikels fertiggestellt hatte, überraschte mich Manuel mit einem weiteren Podcast in dem wir mehr oder weniger spontan über das Thema sprachen...
Während des spontanen Gesprächs kristallisierte sich heraus, dass ich nochmal von vorne anfangen musste. Und zwar ganz von vorn! Hier also der "Versuch" einer geschichtlichen Aufarbeitung des Themas Schlager und seiner Verbindung zum Pop. Einiges konnte ich recherchieren, anderes musste ich mir anhand der wenigen vorhandenen Fakten zusammenreimen. Um es nochmal zu betonen: Ich bin KEIN Musikkritiker, schon gar kein Experte wie es Manuel so scherzhaft ausdrückte! Ich interessiere mich lediglich für Musik und alles was ich im folgenden Aufsatz erzähle muss kritisch hinterfragt werden. Wie eigentlich alles das im Bereich des Journalismus ausgespuckt wird eigentlich kritisch hinterfragt werden sollte, aber das nur am Rande. Weiters teile ich das Ganze in mehrere Teile auf - ist ja doch ein ziemlicher Brocken das Ganze!
1. Die Wurzeln von Schlager und Volksmusik
Der Schlager wird heute vermehrt mit der Volksmusik in Verbindung gebracht. Umso mehr überrascht es, dass er sich ursprünglich stark vom volkstümlichen und traditionellen Kulturgut distanzierte. Er genoss bei den älteren Semestern sogar einen ähnlich schlechten Ruf wie später der Jazz, die Rockmusik, der Punk und der Gangsterrap. Was nach heutigen Maßstäben vielleicht lächerlich erscheint. Man muss aber auch verstehen, dass Traditionen früher noch viel tiefer in der Identität des einfachen Volks verwurzelt waren. Einer Identität geprägt von Entbehrungen, prekären Herrschaftsverhältnissen und geringer Bildung. Man hatte quasi nichts anderes! Wovon die Jugend natürlich unbedingt weg wollte. Sie strebte nach einem besseren Leben, sog alles in sich auf das neu, anders und interessant war, und machte es sich zu eigen. Nichtsahnend, dass ihnen derselbe Generationenkonflikt später mit ihrer eigenen Nachkommenschaft ins Haus stand...
Lange bevor es diese Begriffe überhaupt gab, entwickelte sich beim einfachen Volk, wie in allen Völkern der Erde, eine eigene Musikkultur die während der Arbeit und zu besonderen Anlässen wiedergegeben wurde. Die Kirche welche ihnen den christlichen Glauben noch näher bringend wollte, wusste das sie mit sakralem Gesang allein keinen Blumentopf gewinnen konnten. So sammelten und schrieben sie Kirchenlieder die sich mehr an der volkstümlichen Musik orientierten. Durch ihre weite Verbreitung war die Kirche somit die erste Institution die einer größeren Öffentlichkeit Musik mit Ohrwurmqualität zugänglich machte. Eine Entwicklung die massiven Einfluss auf die Klassische Musik und insbesonderen die Oper auswirkte. Zur großen Erquickung der feinen Gesellschaft, welche sich damals als einzige einen solch teuren Spaß erlauben konnte.
Aber auch im einfachen Volk gab es über die Jahrhunderte einige erfreuliche Neuerungen. Wie die Bänkelsänger, auch Moritatensänger genannt, welche von Ort zu Ort zogen, die Leute mit Neuigkeiten versorgte und Lieder anstimmte, die zum Teil mit auf Tafeln gezeichneten Illustrationen begleitet wurden. Das bekannteste Beispiel eines Moritatensängers lässt sich in Bertold Brecht's
Dreigroschenoper finden (siehe
Die Moritat von Mackie Messer).
Im 19. Jahrhundert kam die Operette auf, musikalische Bühnenwerke mit leichten, heiteren Inhalten und eingängigen Musiknummern. Die klassische Pariser Operette, geprägt vor allem durch den Kölner Cellist und Komponist Jakob "Jacques" Offenbach, übte großen Einfluss auf die Wiener Operette aus, zu deren bekanntesten Stücke Die Fledermaus von Johann Strauß II gehört. Apropos: Eines von Strauß' anderen Meisterwerken, der Walzer An der schönen blauen Donau wurde am 15. Februar 1867 in einer eigenen Fassung vom Wiener Männergesangs-Verein uraufgeführt. In einer zwei Tage später vom Neuen Fremdenblatt veröffentlichten Kritik heißt es: "Die Eröffnungsnummer der zweiten Abteilung war ein entschiedener Schlager." Womit dies die erste belegte Verwendung des Begriffs darstellt.
Der bombastische Erfolg der Wiener Operette brachte eine zunehmende Öffnung den bürgerlichen Schichten gegenüber, die allerdings mit den albernen Frivolitäten der Franzosen nichts anfangen konnten und ein mehr volkstümlicheres, heimatverbundeneres Programm forderten, mit mehr lustspielhaftem und sentimentalem Charakter. Damit in Verbindung gestanden haben dürfte auch der Umstand, dass die Operette das Alt-Wiener Volkstheater aus der Mode gebracht hatte, das vor allem durch seine niederschwelligen Komödien glänzte und zu deren bekanntesten Autoren Ferdinand Raimund und Johann Nestroy zählten. Und man muss wohl auch nicht erwähnen, dass hier erste Einflussnahmen von Vertretern des Nationalismus und Antisemitismus zu spüren waren. Um den Wünschen des neuen Publikums gerecht zu werden, fand schließlich eine kleine Reformation der Wiener Operette statt. In Paris hatte man sich währenddessen zusehends dem mehr zirkusgleichen Varieté zugewandt, wie es im berühmten Moulin Rouge, dem Lido oder dem Folies Bergère präsentiert wurde.
Plötzlich wollte die ganze zivilisierte Welt ihr eigenes Varieté haben. In England nannte man sie
Music halls, in den USA
Vaudeville - nach einer gleichnamigen Frühform des französischen Chansons im 15. Jahrhundert. Der Variantenreichtum des Varietés gestattete es neuen Formen der Unterhaltung zu blühen und zu gedeihen, wozu in Amerika natürlich auch Ragtime, Jazz, Blues, sowie der Country gehörten. Zwar gab es damals noch kein Internet, geschweige denn leistbare Tonträger, doch wurden bereits gedruckte Notenblätter rege ausgetauscht die man über den großen Teich mitnehmen und dem geschätzten Varieté-Publikum als exotische Spezialität vorspielen konnte.
Fortsetzung folgt
#FEEDBACK