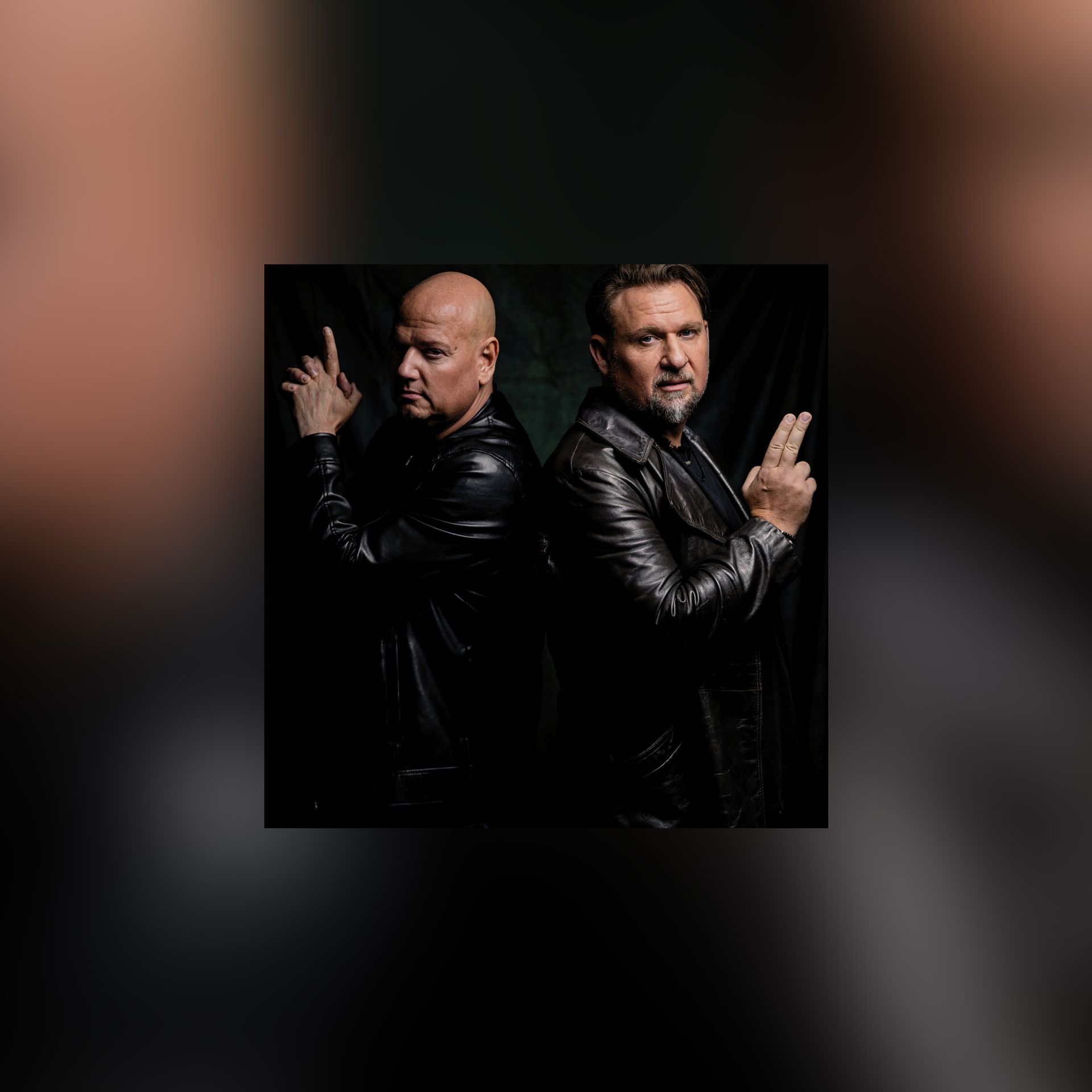KUNST VS PERFEKTION
Kunst muss makellos sein! Stimmt das oder ist es gerade der Makel der die Kunst vom Gewöhnlichen unterscheidet?
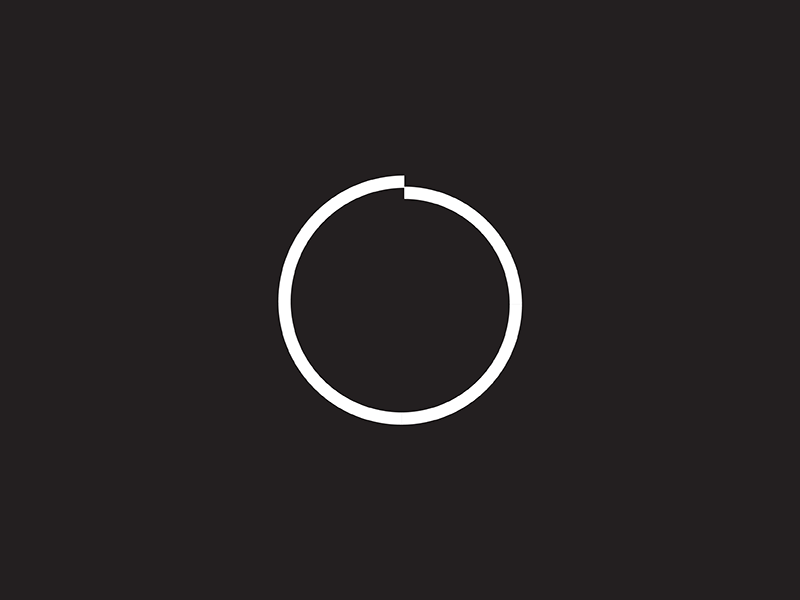
Der Dilettant unterscheidet sich aber auch dahingehend von einem Fachmann, als das er seine Kunst vorwiegend ihrer selbst wegen, also aus einem Interesse, einer Leidenschaft heraus ausübt. (Siehe auch: L'art pour l'art) Der Dilettantismus war auch Kernstück einer Westberliner Bewegung in den 1980ern, den Genialen Dilletanten (die falsche Schreibweise war mehr oder weniger beabsichtigt) die darin eine Gegenbewegung zum kommerziellen, elitären Kunstmarkt sahen und - ähnlich dem Kintsugi - Fehler als individuellen Bestandteil ihrer Kunst ansahen. Zu den Genialen Dilletanten zählten u.a. die Einstürzenden Neubauten, Die tödliche Doris, Sprung aus den Wolken, Westbam, Christiane F (Wir Kinder von Bahnhof Zoo) und viele mehr.
Berufs- vs Hobbykünstler
Im professionellen Kunstbetrieb wird gern zwischen den Berufskünstlern und den Hobbykünstlern unterschieden. Berufskünstler seien Meister ihres Fachs, die sich ihr Brot hart erarbeiten müssen. Dementsprechend abfällig äußern sie sich auch schon mal gegenüber der "Hausfrauenfraktion." Leutchen die einfach lustig vor sich hin künsteln, ohne Sinn für's Feinstoffliche und ohne wirklich was zu riskieren.
Diese Einschätzung ist nicht nur unverschämt und falsch, denn es gibt sehr wohl eine große Grauzone was die Kunst betrifft. Sie scheint auch vornehmlich dem Zweck zu dienen die nicht zu unterschätzende Konkurrenz schlecht zu reden, die es mitunter durchaus mit namhaften Künstlern aufnehmen könnte und dabei viel günstiger und unproblematischer ist. Denn "Hausfrauen" haben es nicht nötig unentwegt den Exzentriker raushängen zu lassen, um auf sich aufmerksam zu machen. Ginge es allein ums Handwerk wären Berufskünstler dieser Tage ohne Zweifel aufgeschmissen. Was ihnen tatsächlich zugute kommt sind ihr Wissen, ihre Erfahrung und Kontakte, ihre Fähigkeit den richtigen Leuten Honig ums Maul zu schmieren und das nötige Geschick zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Es geht im Grunde ums richtige Marketing, so unsympathisch das auch klingen mag!
Was sie sich nicht erlauben können sind Fehler, da sie mit jedem Risiko ihre eigene Existenz auf's Spiel setzen! Dadurch schränken sie sich enorm in ihren Möglichkeiten ein. Denn wo keine Fehler gemacht werden können und man die Laborsituation scheut, davor Angst hat einmal ordentlich auf die Fresse zu fallen, wieder aufzustehen und mit wissendem Grinsen die blutende Nase am Ärmel abzuwischen, entsteht selten etwas wirklich Neues und Innovatives. Ein guter Zwischenweg ist die Symbiose, zwischen der Hoch- und Subkultur, aber auch - im Sinne der Transdisziplinarität - die Symbiose zwischen Kunst und Wissenschaft. Das ist allerdings schon wieder eine ganz andere Baustelle...
Schwellenangst
Gerade am Anfang ihrer Karriere geht es jungen Künstlern wie dem Hasen vor der Schlange oder dem Germanisten vor dem weißen Blatt Papier: Die ersten Schritte wollen genau überlegt sein. Sie versteifen sich zu sehr darauf von Anfang an einen guten Eindruck zu hinterlassen und geben nichts aus der Hand, aus Angst sich die Reputation kaputt zu machen. Als wäre die Reputation sowas wie eine Lizenz sich überhaupt künstlerisch betätigen zu dürfen.
Die Wahrheit ist: Fehler gehören dazu! Es tut anfangs weh, aber wir lernen eine Menge daraus, sollten uns also auch nicht vor negativem Feedback fürchten. Negatives Feedback ist sogar besser als positives Feedback, denn Letzeres streichelt zwar unser Ego, aber wir haben nicht lang was davon. Wer einem negatives Feedback gibt suggeriert zumindest, dass er sich mit der Sache beschäftigt hat und sie als wertvoll genug erachtet, sich noch einmal mit ihr auseinander zu setzen. Was man von dem Feedback annimmt ist jedem selbst überlassen, im schlechtesten Fall erfährt man wenigstens etwas über seine Klientel.
Eine Strategie gegen die Schwellenangst wäre es, sein Werk erstmal im kleinen Rahmen zu erproben. Möglichst nicht mit wohlmeinenden Freunden und Verwandten, es müssen schon auch Fremde im Spiel sein, damit das Feedback ungezuckert und ehrlich ist. Wer will kann auch erstmal ein Pseudonym verwenden oder eine Maske tragen. Sich hinter Gegenständen zu verstecken ist allerdings auch nicht zielführend, da man die Übung vor Publikum aufzutreten ja braucht.
Ist das Kunst?
Kunst die ehrlich überzeugen soll bedarf einer Sache am allermeisten: Nicht Perfektion, sondern Authentizität. Es darf nicht der Eindruck entstehen, dass einem etwas untergejubelt wird, das lieblos zusammengeschustert oder auch mit viel harter Arbeit, doch ohne Herz und Hirn erzeugt wurde. Vielmehr soll man glauben können, dass die Arbeit ernst genommen wurde, dass man sich auch bei wenig Aufwand zumindest Gedanken gemacht oder einem Impuls gefolgt ist, der aus einem Selbst gekommen ist, nicht aus der bloßen Notwendigkeit oder gar Langeweile heraus.
Das Publikum zu unterschätzen ist töricht! Man braucht kein Kunstverständnis oder scharfen Verstand um zu spüren, ob etwas ehrlich gemeint ist oder nicht. Und Fehler dürfen gemacht werden, solange man sich ehrlich bemüht! So wächst das Publikum mit dem Künstler und die Kunst wird zu mehr als einem dekorativen Gefäß. Sie wird individuell, kostbar und erzählt womöglich eine interessante Geschichte!
#FEEDBACK