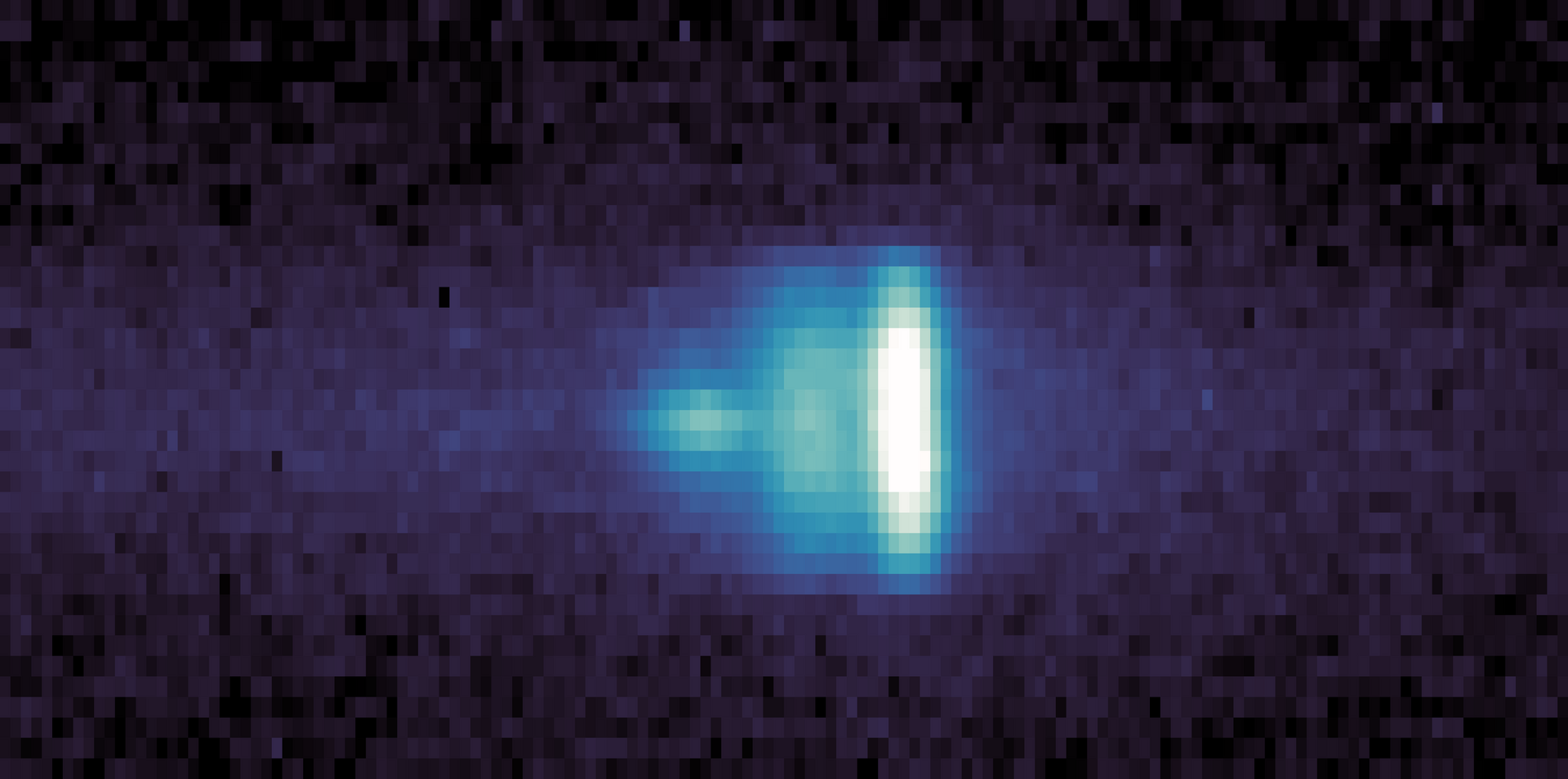Bestes Beispiel ist die deutsche ZDF-Produktion Ijon Tichy: Raumpilot, frei basierend auf dem Sammelband Sterntagebücher des polnischen Science-Fiction-Autors und Visionärs Stanisław Lem (1921 - 2006), der bereits in den 1970ern Errungenschaften wie Nanotechnologie, Neurale Netzwerke und virtuelle Welten vorhersah und sich mit einem kritischen Realismus, der nie einem Sinn für's Absurde entbehrte, den Problematiken seines Genres, der Wissenschaft und menschlichen Natur im Gesamten annahm. Zu seinen bekanntesten Werken zählen neben den Sterntagebüchern die Romane Solaris - der mehrmals verfilmt wurde, zuletzt mit George Clooney in der Hauptrolle - und Der futurologische Kongreß. Die Futurama-Folge "Planet der Roboter" basiert übrigens auch auf einem Kapitel der Sterntagebücher, genauer die Elfte Reise.
IJON TICHY: RAUMPILOT

Alle Buchadaptionen für Film und Fernsehen teilen ein Problem: Wie nah an der Vorlage dürfen sie sein? Wer sich haarklein an jedes Detail hält muss sich gegebenenfalls anhören eine redundante Kopie erstellt zu haben, der es an Herz und eigener Perspektive mangelt. Zu sehr abschweifen darf man aber auch nicht, sonst zerreißen einen die Fans in der Luft. Eine Gratwanderung die nicht jedem gelingt!
Dann gibt es jene Adaptionen die vom Original zwar inspiriert wurden, bei den Charakteren und Storyelementen bedienen, aber letztlich etwas ganz Eigenes damit anstellen. Ein Sakrileg, wenn schlecht gemacht und nur zum Zwecke der Gewinnmaximierung auf Kosten eines bekannten Urhebers produziert! Es kann dabei aber auch etwas herauskommen, das auf seine Weise originell und interessant ist. Das sich künstlerische Freiheiten nehmen kann und trotzdem die Vorlage respektiert. Das nicht vorgibt dem Werk vorzustehen, sondern als eigenständige Entität zur Seite.
1999 und 2000 produzierten Randa Chahoud, Dennis Jacobsen und Oliver Jahn, damals Studenten der Deutschen Film- und Fernsehakademie Berlin (dffb), ihre beiden ersten Kurzfilme die frei auf Lem's Werke und im Speziellen die Figur des Ijon Tichy basierten. Das Trio schrieb gemeinsam die Drehbücher und führte auch Regie, Jahn übernahm zudem die Hauptrolle. Gedreht wurde, wie später in der ersten Staffel der Serie in seiner Privatwohnung in Berlin. Insgesamt sollte der Eindruck entstehen, dass sich Tichy seine Reisen durchs All nur einbildet.
Die Trashfilme sollten zunächst nur als Übungsstücke dienen und waren ursprünglich nicht einmal für die Öffentlichkeit gedacht. Nachdem sie dann aber doch bei Festivals landeten und ein paar Preise gewannen, wurde ihnen klar, dass sie damit weitermachen wollten. 2005 gründeten sie die Produktionsfirma Kosmische Kollegen, mit der sie aus dem überarbeiteten Konzept eine Comedyserie für den ZDF produzierten, deren erste Staffel 2007 ausgestrahlt wurde.

Die großen Unterschiede zum Original sind, dass Ijon Tichy in den Büchern trotz seiner absurden Eskapaden ein ernster intellektueller Mann ist der viel auf seine Prinzipien hält. Jahn's Darstellung hingegen zeigt ihn als zwar durchaus klugen, aber unordentlichen Menschen der wenig wert auf sein Äußeres legt. Sein Tichy bedient sich nicht einer klaren Sprache, sondern einem pseudoausländischen Dialekt mit Wortverdrehungen, die innerhalb des Serienuniversums aber zu einem gesamtgalaktischen Phänomen geworden zu sein scheinen - entweder das, oder Tichy bildet sich das Ganze tatsächlich nur ein. Die Ausstattung besteht, in Anlehnung an Raumpatrouille Orion (1966) wo schon mal ein Bügeleisen als Steuerelement herhalten musste, großteils aus alten Vintage-Küchen- und Wohn-Utensilien. Insgesamt wird sehr viel Retrochic mit zeitgenössischen und futuristischen Elementen verbunden. Der Einsatz von CGI ist stark reduziert, um der Serie mehr Substanz zu verleihen.
Tichy zur Seite steht die Analoge Halluzinelle, gespielt von Nora Tschirner, die auch Fans des
Tatort
ein Begriff ist. Sie ist eine von Tichy geschaffene K.I. die ihm im Form eines Holograms assistiert. Chahoud, Jacobsen und Jahn, haben sie speziell für die Serie erfunden, da Tichy sonst in den Büchern kaum einen Ansprechpartner hat. Weiters dazu gedichtet wurde die von einer Puppe dargestellte Figur des Mel (gesprochen von
Jan Mixsa), dem Assistenten von Professor Tarantoga, welcher in den
Sterntagebüchern
und im
Futurologischen Kongress
- dort in manchen Übersetzungen auch als Professor Trottelreiner genannt - Tichy's Freund, hier aber eine Art Gegenspieler darstellt. Beide tauchen erst in der 2011 erschienenen zweiten Staffel auf.

Tichy mag hier auf den ersten Blick wie ein junger Prolet rüberkommen, der sich Weird Science-mässig eine Freundin zum rumknutschen und putzen gebastelt hat. Dem entgegen dreht sich die Handlung aber um interessante Ideen, Konzepte, Erfahrungen und ihre Konsequenzen, mit denen sich Lem schon vor langer Zeit beschäftigt hat. Wie Zeitparadoxa, die Implikationen von Teleportation, Künstlicher Intelligenz, Kommunikation mit anderen Völkern, virtueller Realität und Umweltthemen.
Die Serie bedient sich einiger der üblichen Tropes des Science-Fiction-Genres, spielt subtil auf Star Wars, Star Trek, Per Anhalter durch die Galaxis und andere zeitgenössische Werke an, steht aber robust auf eigenen Beinen. Nach Ende von Ijon Tichy: Raumpilot ist es wieder still geworden um das Trio Chahoud, Jacobsen und Jahn. Regisseur Dennis Jacobsen drückte allerdings seinen Wunsch aus, die Reihe eines Tages mit einem Spielfilm fortsetzen zu können.
Hier nun ohne weiteres Gewese, die erste Staffel von Ijon Tichy: Raumpilot, frei nach Stanisław Lem...
#FEEDBACK