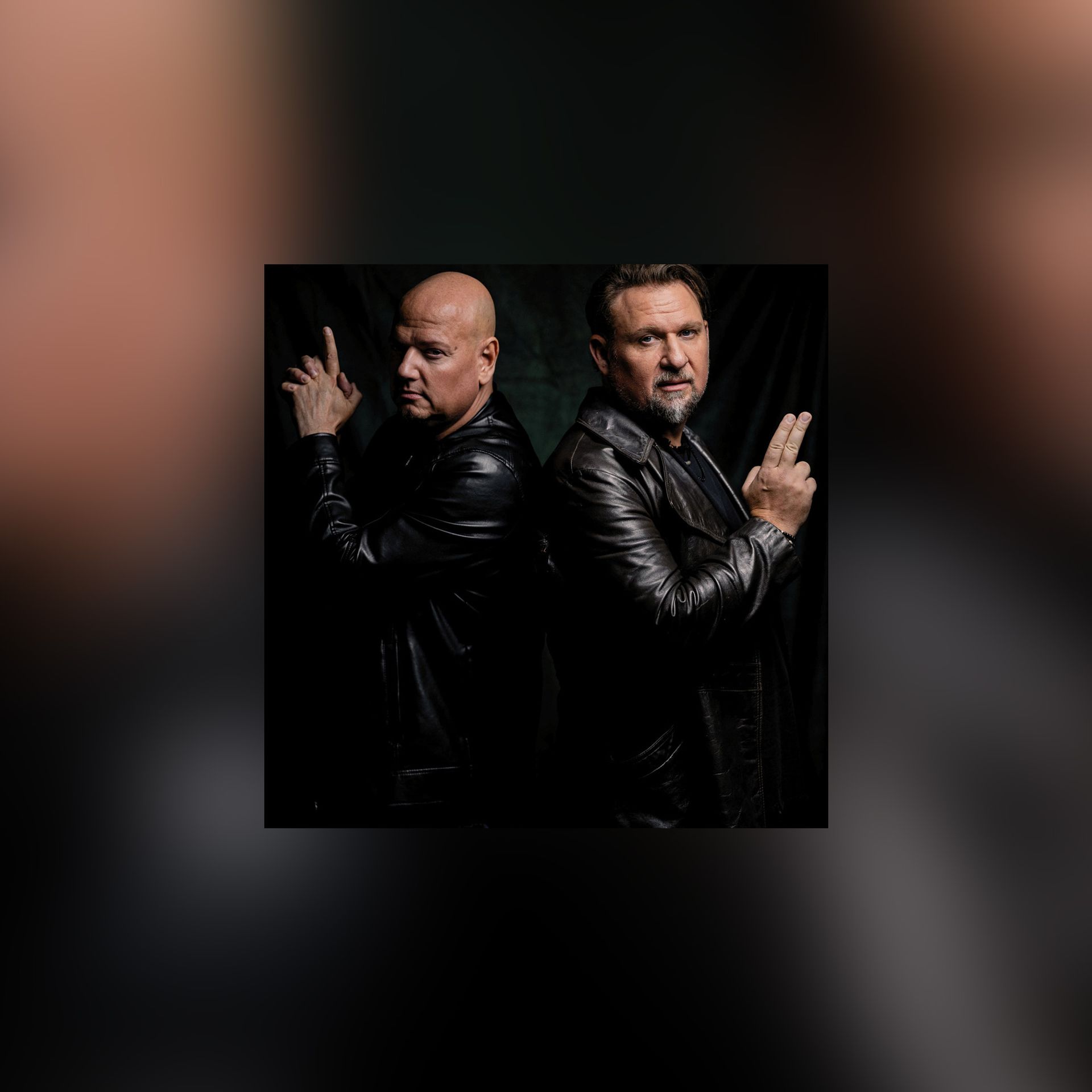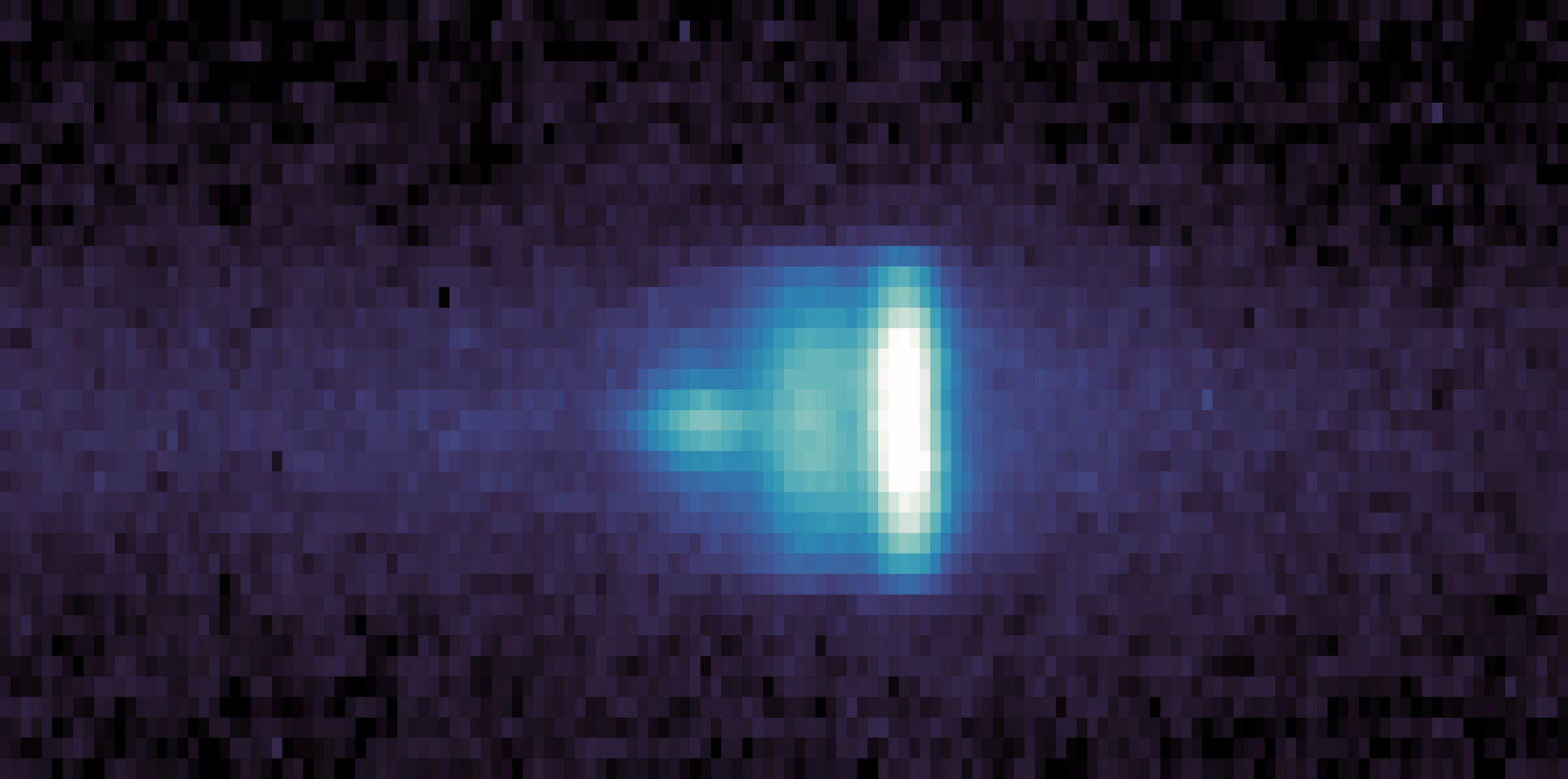HELLO DALL·E // FLUCH ODER SEGEN?

Viele Künstler*innen haben das Problem eine Idee im Kopf zu haben, diese aber nicht umsetzen zu können, da ihnen das nötige Talent fehlt, oder das Geld jemanden mit der Realisierung ihrer Vision zu beauftragen. KI-gestützte Software wie DALL-E kann da Abhilfe schaffen. Ein Programm der Non-profit-Organisation OpenAI, das mithilfe von Textbeschreibungen Bilder generiert - je detaillierter desto besser. Es bringt einige erstaunliche Bilder zustande, wie jenes oben. Man kann aber auch sehen, dass die Ergebnisse nicht immer perfekt sind und einige Mängel aufweisen.
DALL-E ist an und für sich gratis. Um darauf zugreifen zu können, muss man sich aber zunächst auf eine Warteliste eintragen und eine Weile warten. Einmal drin kann man sofort loslegen. Wie oft man etwas generieren kann hängt von der Zahl der Credits ab, von denen man Einige geschenkt bekommt. Wem diese nicht reichen, der/die kann sich für 15 Dollar 115 weitere Credits kaufen oder einfach warten, da man einmal im Monat 15 weitere Credits geschenkt bekommt. Einfache Wünsche verschlingen deutlich weniger Credits als wenn man die AI an seine Grenzen bringen möchte. Experimente in der Formulierung können die unterschiedlichsten Ergebnisse hervorbringen, was entweder unglaublich befriedigend oder furchtbar frustrierend sein kann. Je nachdem was DALL-E bereits gelernt hat.

A DALL-E 2 generated image of "a monkey astronaut in space". Author: Icygyrosi - CC-BY-SA-4.0
Programme wie DALL-E werden in der Kunstwelt und vor allem unter berufstätigen Grafikdesignern verständlicherweise kritisch beäugt. Schon jetzt haben sie es mit einem hartumkämpften Markt zu tun. Den Meisten ihrer Klienten wäre es sogar am Liebsten, sie würden für lau arbeiten. Ein Wunsch den ihnen die KI gern erfüllt, solange es keine Sonderwünsche gibt! Für die braucht es im Moment immer noch Fachleute, echte Menschen mit denen man reden kann und die ins Detail gehen. Das spart einem zwar kein Geld, aber eine Menge Zeit und führt meist zu weitaus besseren Resultaten. Noch!
Die Befürchtung ist groß, dass uns die KI eines Tages restlos ersetzt. Schon jetzt werden auf etlichen Webseiten Klauseln etabliert, die das hochladen KI-generierter Bilder verbietet. Ein Argument das dabei zur Sprache kommt, ist dass sich DALL-E und Co. bei bereits bestehenden Bilder bedienen, zum Teil von Künstler*innen die dem niemals zugestimmt haben. Was nicht ganz richtig ist! Die KI setzt keine Versatzstücke zusammen wie eine Collage - ein Prinzip das übrigens schon seit Jahrzehnten etabliert ist - sondern erkennt Muster, lernt sie zu interpretieren und generiert jedes Bild neu. Aber gut, sagen wir mal DALL-E erzeugt ein Bild, das zufällig dem Werk oder Stil eines etablierten Künstlers gleicht. Wer kann dafür belangt werden? Die Person die das Ganze generiert hat?! Viel Spaß vor Gericht, denn wie soll man nachweisen, dass der User vom Ursprung eines Versatzstückes gewusst und die willentliche Entscheidung getroffen hat, dieses zu nutzen! Die Entwickler von DALL-E?! Auch schwer, da sie ihrer Maschine lediglich beigebracht haben Muster zu erkennen und zu verarbeiten. Lernen ist nicht verboten!

A DALL-E Flow request with the text prompt "a horse with legs over the shoulders of an astronaut" gives the desired image, but the text prompt "a horse riding on the shoulders of an astronaut" only shows images of an astronaut riding a horse and not the other way around. Author: AI Qu - CC-BY-SA-4.0
Man ist versucht sich zu fragen wo das alles hinführen soll. Dabei braucht man nur einen Blick in die Vergangenheit zu werfen: Die Industrialisierung hat vielen Leuten den Job gekostet und etliche Berufe redundant werden lassen. Gleichzeitig haben sich aus den Veränderungen neue Möglichkeiten ergeben. Irgendwer musste die Maschinen ja schließlich warten und es brauchte Ingenieure um sie stetig zu verbessern. Was genauso gut in einem Nullsummenspiel hätte enden können, wäre man nicht darauf angewiesen gewesen, dass jemand das ganze Zeug kauft, das in den Fabriken hergestellt wurde. Zum ersten Mal profitierte man weniger von Arbeitskräften, als von Konsumenten. Und Letztere brauchten Zeit die ihnen angebotenen Waren zu nutzen. Als sich die Arbeiterbewegungen damals für mehr Freizeit einsetzten, waren daher einige Visionäre durchaus auf ihrer Seite. Diese Entwicklung machte auch das Kunstschaffen einem viel breiteren Klientel zugänglich und veränderte unsere Kunstverständnis von Grund auf.
Die Etablierung von Programmen wie DALL-E mag also zunächst ein Alptraum für jene sein, die von ihrer Kunst leben möchten. Es ist aber nicht gesagt, dass sie davon nicht auch langfristig profitieren können! Der internationale Kunstmarkt ist zu einem schmutzigen Geschäft verkommen, das den Nachwuchs klein hält und nur die profitabelsten Akteure ins Scheinwerferlicht stellt - siehe dazu: Adam Ruins Everything - How the Fine Art Market is a Scam. Die Grenzen zwischen dem aufzuweichen was die Eliten als Dilettantismus und "ernstzunehmende Kunst" trennen, ist daher sehr wohl im Interesse Vieler, vor allem junger Künstler*innen. Wenn überhaupt lässt sich argumentieren, dass hier ein viel persönlicherer Zugang zur Kunst begünstigt werden könnte. An kreativem Potential mangelt es zumindest nicht!
Man kann nur abwarten und sehen wohin uns die neue Technologie führt. Angst ist allerdings ein schlechter Ratgeber!
#FEEDBACK