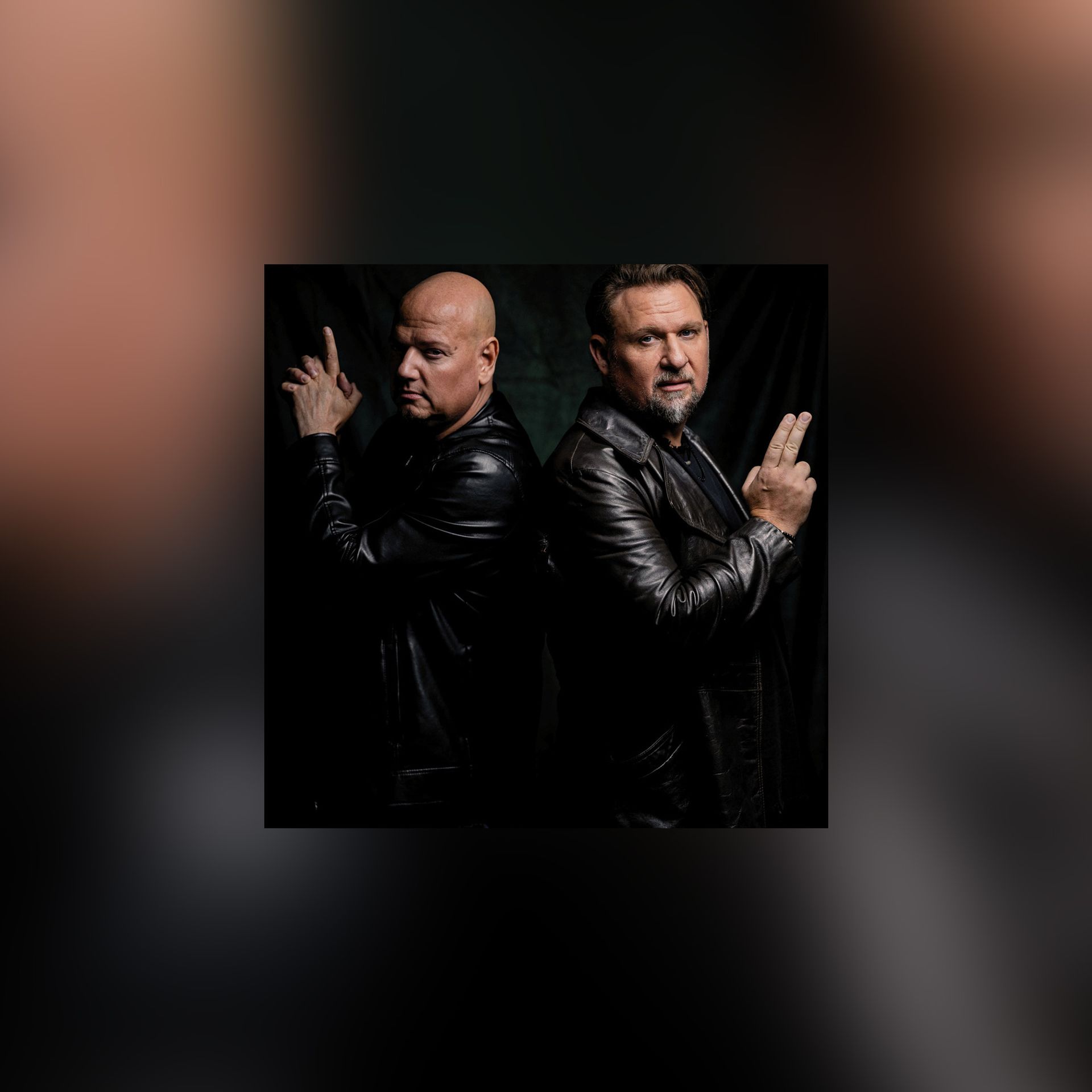EXPERIMENTELLE KLANGERZEUGUNG 101

Source: Andrea Neumann's "Inside Piano" (2010) am Goethe-Institut Boston, basierend auf John Cage's "Prepared Piano".
Schon der Frühmensch experimentierte mit der Erzeugung von Klang und der daraus resultierenden Produktion von Musik. Klopft man die richtigen Steine gegeneinander, die einen schönen Klang erzeugen, ist der nächste Schritt dies in einem gewissen Rhythmus zu tun, der um weitere Impulse ergänzt werden kann, wie Gesang oder Tanz. Und so weiter. Irgendwann entdeckte man die Vorzüge von Fell das über einen geeigneten Resonanzkörper gespannt, einen noch lauteren klareren Ton erzeugte, der sich, je nachdem wie man das Ganze anschlug, weiter variieren ließ. Dabei entstanden auch Variationen im Rhythmus, die zu weiteren Experimenten anregten. Kurz: Das Spiel mit Klang und Musik zählt zu den inspirierensten Kunstformen seit Anbeginn der Menschheit.
Man könnte noch lange über die Entwicklungen der Klangerzeugung sprechen, über die ersten Blas- und Saiteninstrumente, Pythagoras und die Harmonielehre... doch soll das nicht Gegenstand unseres heutigen Artikels sein, sondern jene Experimente die noch garnicht so lange her sind und immer noch großes Potential in sich bergen. Wie das Prinzip der
Intonarumori, einer Erfindung des italienischen Futuristen Luigi Russolo (1885 – 1947). Dieser kategorisierte in seinem Manifest "L’arte dei rumori" (Die Kunst der Geräusche) von 1913 erstmals alle Formen von Geräuschen und stellte die damals provokante These auf, dass man sie nicht aus der Musik ausschließen dürfe.
Bevor Russolo daher kam, hatte sich Musik zu Etwas entwickelt das harmonisch und rein im Klang sein sollte. Geräusche wie "Brummen", "Rauschen" oder "Zischen" zählten definitiv nicht dazu. Um das Gegenteil zu beweisen erfand er eine Reihe von Instrumenten, welche eine breite Palette dieser Geräusche erzeugten, die sogenannten Intonarumori, die Russolo im Verbund mit einem Orchester zur Aufführung brachte. Der Erfolg seines Experiments blieb zunächst aus, auch weil in der Zwischenzeit der Erste Weltkrieg losgebrochen war. Die Geschichte gab ihm in dem Punkt aber recht und Russolo gilt heute als Vater der Noise-Musik, auch wenn seine Bekanntheit von der Tatsache getrübt ist, dass sich die italienischen Futuristen später mit den Faschisten ins Bett legten.
Ein weiteres interessantes Experiment war das Präparierte Klavier des Amerikaners John Cage (1912 - 1992). Inspiriert von Henry Cowell (1897–1965), der als einer der Ersten mit dem Innenleben des Klaviers experimentierte und beim Spielen schon mal direkt hinein griff, begann Cage in den 1930ern damit Schrauben zwischen die Saiten zu stecken und basierend auf den daraus resultierenden, mehr abgehakten rhythmischen Klängen ganze Musikstücke zu komponieren.
Die Präparierung von Klavieren und vergleichbaren Tasteninstrumenten fand seither vielfache Verwendung. Cage selbst präparierte für das Stück "All Tomorrow's Parties" (1967) von The Velvet Underground & Nico ein Klavier mit Büroklammern. Jazzlegende Dave Brubeck verwendete für sein Stück "Blues Roots" von 1968 Kupferstreifen um einen Honky-Tonk-Sound zu erzeugen. Jüngeren Lesern dürfte dazu auch Aphex Twin's Album "Drukqs" von 2001 einfallen. Wir möchten euch aber vor allem den zeitgenössischen deutschen Komponisten Volker Bertelmann alias Hauschka ans Herz legen...
Das Experiment mit Tonträgern brachte auch einige interessante Neuerungen mit sich. Es gibt Instrumente die auf geloopten Magnetbändern basieren, deren Output beliebig moduliert werden kann. Dann natürlich die Vertreter der Musique Concrete, die Bänder zerschnitten, neu arrangierten, in unterschiedlichen Geschwindigkeiten überspielten und so weiter. Obwohl es die Schallplatte schon wesentlich länger gab, kam die große Revolution mit ihr erst in den 1970ern, mit dem Turntablism, der Musikstile wie den Hip Hop prägte. Umso ironischer, dass es sich bei der ersten kommerziell erfolgreichen Single die das Scratchen einer breiten Öffentlichkeit bekannt machte, ausgerechnet um "Rockit" von Jazzmusiker Herbie Hancock handelte.
Und dann gab es da natürlich noch den Künstler Christian Marclay, der die Cut-Up-Prinzipien der Musique Concrete auf den Turntablism übertrug, kurz: Schallplatten zerteilte und neu zusammenklebte. Das Ergebnis war in gewisser Weise schon noch Musik, bestand aber eben aus kurzen Versatzstücken, die sich unentwegt in die Quere kamen, abwechselten und einen ungeahnt komplexen Rhythmus erzeugten. Ein Sound der durch das spätere Microsampling - mit Interpreten wie John Oswald (dazu auch unser Beitrag Plunderphonics - Alles nur geklaut?) oder Akufen - und dem IDM/Glitch zunehmend an Bedeutung gewann.
Der Plattenspieler selbst erweist sich allerdings auch als ein hervorragendes Hilfsmittel zur Klangerzeugung, wie uns der britische Künstler Graham Dunning im nächsten Video beweist. Nicht nur macht er sich Marclay's Technik zunutze, um einen einfachen Beat zu erzeugen, er nutzt auch die Drehung des Turntables zum mechanischen Anspiel mehrerer Elemente die er Schicht für Schicht übereinander legt.
Heutzutage hat man oft den Eindruck, es gäbe keine Innovation mehr in der Musik. Dass sich noch immer auf so viele Arten und Weisen mit Klang experimentieren lässt, gibt allerdings Grund zur Hoffnung. Besonders, da man sich mit etwas Kreativität so einfachen Hilfsmittel zunutze machen kann wie Magneten. Hier also zum Abschluss ein Beitrag von Youtube-Channel Magnetic Games...
#FEEDBACK