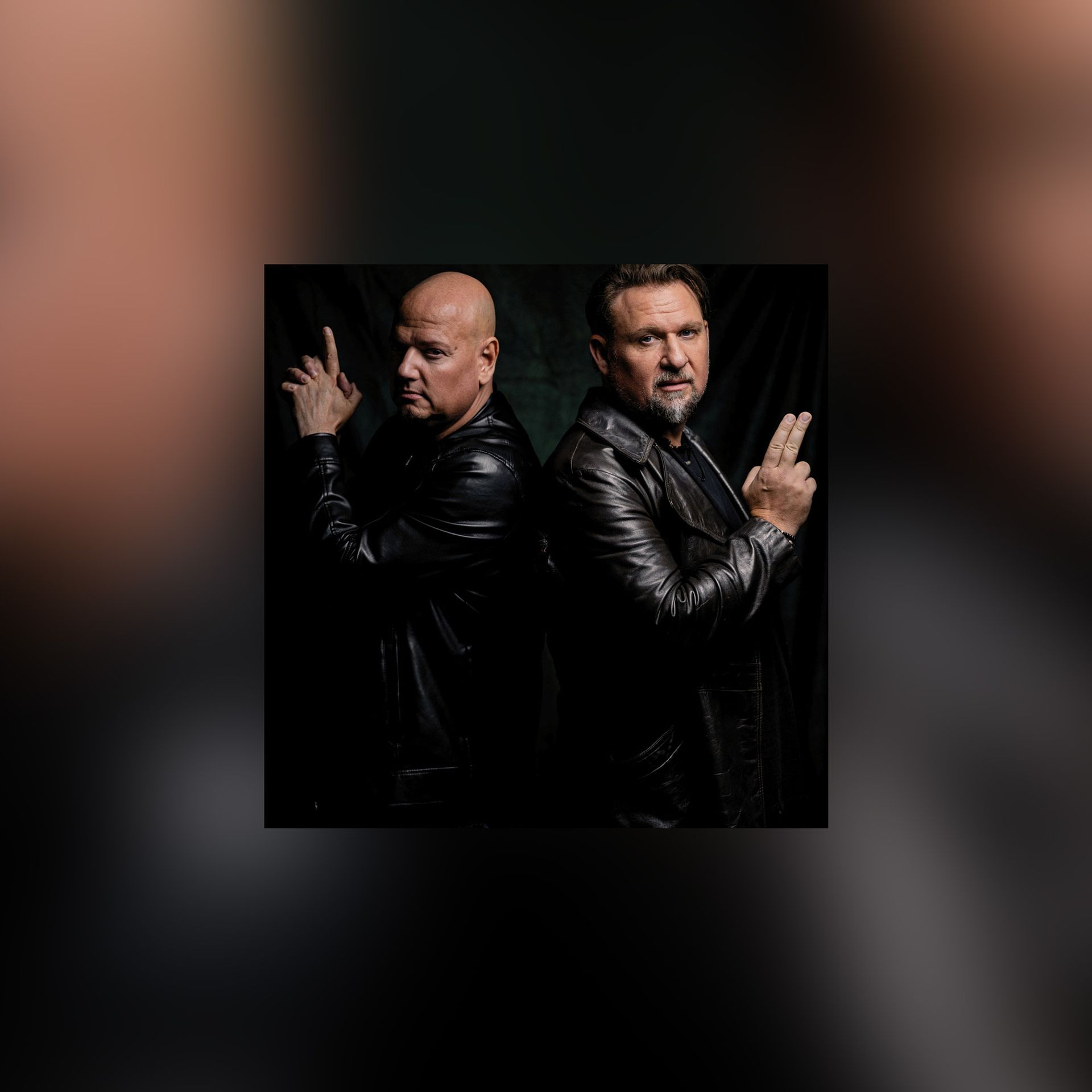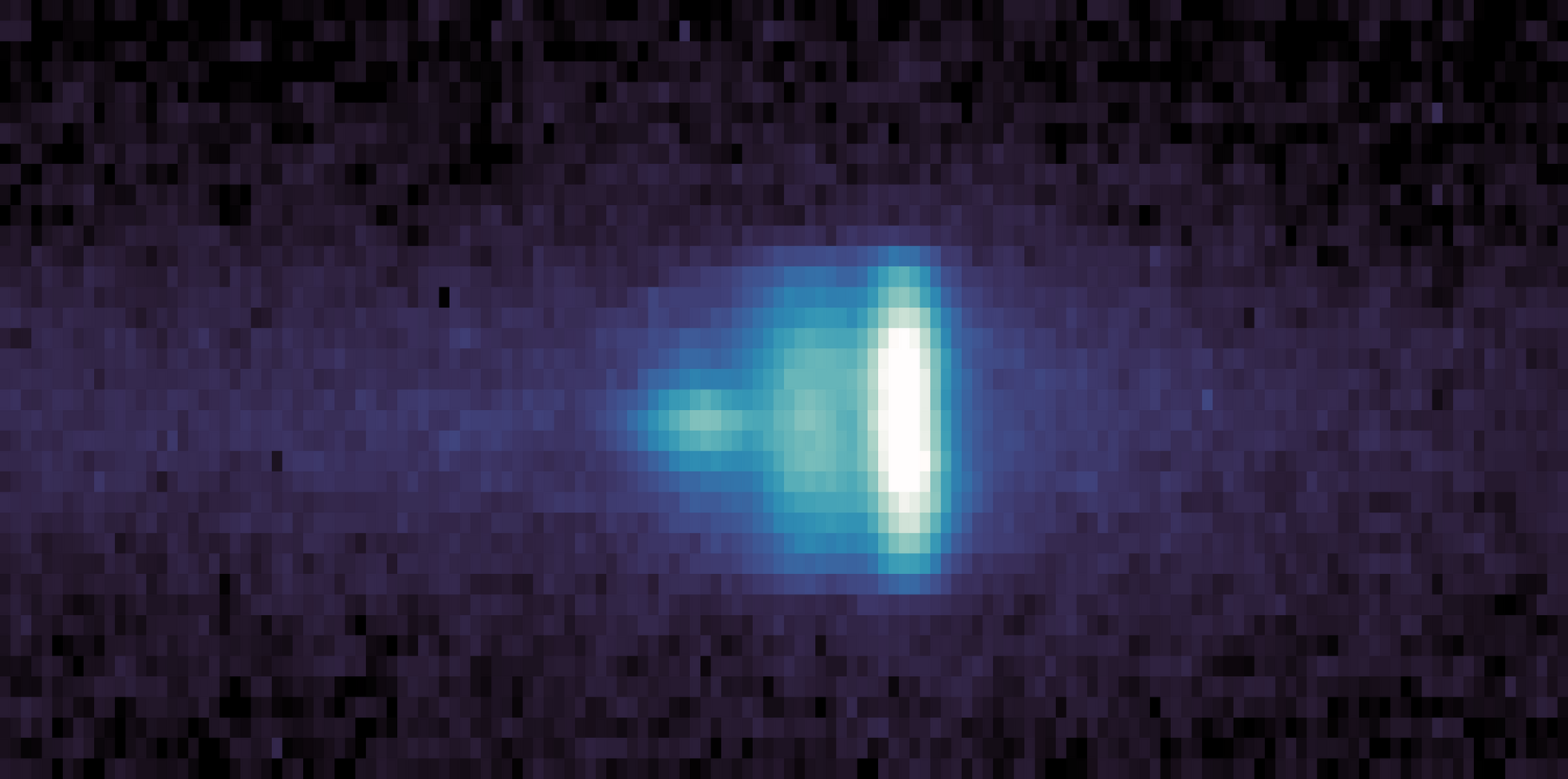DIE GESCHICHTE DES SCHLAGERS (2)

Source: Christine Görner und Rudolf Lenz in „Mein Mädchen ist ein Postillion“ von Rudolf Schündler aus dem Jahr 1958. Foto: Betafilm
2. Schellack, Rundfunk, Heimatfilm
Ende des 19. Jahrhunderts etablierte sich eine Unterscheidung zwischen zwei Sorten von Musik: U (Unterhaltungsmusik) und E (Ernste Musik). Diese Unterscheidung spielte vor allem mit der Erfindung der Schallplatte, des Radios und der Entstehung von Verwertungsgesellschaften wie der späteren AKM oder GEMA eine wichtige Rolle. Zur E-Musik gehörten Beiträge mit künstlerischem Anspruch wie die Klassische Musik, die höher bewertet und damit besser vergütet wurden als die U-Musik. (Noch heute erhalten klassische Musikstücke, wie sie beispielsweise auf Ö1 laufen, höhere Tantiemen. Allerdings befinden sich diese auch nicht in einer "Rotation", werden also nicht so häufig gespielt, weswegen beispielsweise Vertreter der Pop und Schlagermusik weitaus besser aussteigen.)
Durch den Siegeszug des Grammophons nach Ende des Ersten Weltkriegs und insbesondere während der Goldenen Zwanziger Jahre, kristallisierte sich der Markt der Unterhaltungsmusik als äußerst rentabel heraus, zumal sich zu klassischer Musik nicht wirklich flott tanzen ließ. Und gerade das Tanzen war für die Jugend von damals das Größte. Die ersten Schlager kamen auf den Markt und drangen mit Betriebnahme der Rundfunkanstalten bald in jeden Haushalt vor. Parallel dazu erlangte auch das französische Chanson weiter an Beliebtheit. Aus dem Varieté heraus entstand zudem das Musical, welches über den New Yorker Broadway und das Londoner West End aus zunehmend von sich hören machte.
Derweil entwickelte sich in Amerika, beziehungsweise aus den Bars und Bordellen New Orleans' heraus, der Jazz, welcher sich über die Grenzen Louisiana's weiterformte und bald auch über den großen Teich zu uns rüber schwappte. Hier warf er das ganze, ohnehin schon problematische Konzept von U & E vollends über den Haufen, denn Jazz ist sowohl anspruchsvoll als auch unterhaltsam. Mehr noch, entstand mit Jazz eine der ersten eigenen Jugendbewegungen im deutschsprachigen Raum, die mit auffälliger Kleidung und gewagten Tanzbewegungen gegen das strenge Sittenbild des langsam aufkommenden Nationalsozialismus rebellierten. Parallel dazu war der Schlager auch vollends bei der älteren Generation angekommen und lief Gefahr das Monopol auf die Jugend an die Amerikaner abgeben zu müssen.
Das Problem verflüchtigte sich zunächst mit dem Aufstieg der Nazis, die Jazz zu einer entarteten Musik erklärten und jeden harscht bestraften, der es wagte ihn auch nur zu hören. Der Schlager hingegen, wie auch die Volksmusik, wurden als Teil der deutschen Kultur anerkannt und zu Propagandazwecken genutzt, unterliefen allerdings einer entsprechende Zensur. Viele einstige Schlagerstars wie die Comedian Harmonists mussten das Land verlassen oder wurden später in KZs brutal ermordet. Mit den albernen Frivolitäten vergangener Tage wurde aufgeräumt, was gespielt wurde hatte sauber und anständig sein. Gleichzeitig wurden aufkeimende Stars wie Zarah Leander und Heinz Rühmann eingespannt. Als bekanntester Schlager dieser Zeit gilt Lale Andersen's bereits 1915 getextetes "Lili Marlen" welches 1942 verboten wurde, als bekannt wurde, dass die Sängerin Kontakte zu Juden in der Schweiz pflegte.
Nach Ende des Zweiten Weltkriegs und durch die massive Präsenz der alliierten Truppen in den Besatzungszonen, kehrte die Jugend dem Schlager erneut den Rücken um sich wieder mehr dem Jazz zu widmen, der sich in der Zwischenzeit mit dem Bebop massiv weiterentwickelt hatte. Udo Jürgens, damals noch mitten im Studium, trat regelmäßig im klagenfurter Café Lerch als Jazzmusiker auf, spielte auf Wunsch des Publikums aber auch gerne volkstümliches Liedgut.
Die Vertreter von Schlager und Volksmusik wollten von ihrem problematischen Image weg und kehrten gemeinsam zu ihren humoristischen Wurzeln zurück. Eine Vielzahl der in den Nachkriegsjahren entstandenen Schlager scheinen tatsächlich einfach Faschingslieder zu sein. Gleichzeitig machten sie sich die Nostalgie von einer guten alten Zeit zunutze, die sich in sentimentalen Balladen, schwungvollen Marschtakten zum Mitklatschen und zum Schunkeln anregenden Seemannsliedern wiederspiegelte.
Zudem hatten sie einen großen Trumpf im Ärmel: Den Heimatfilm. Die heile Welt in der schönen Natur der Alpen, in denen Liebe, Freundschaft und Familie noch was wert sind. Wo der Zweite Weltkrieg und der Holocaust scheinbar niemals stattgefunden haben. Leichte Unterhaltung mit gutem Schmäh, verklärtem Blick und bewegender Musik, die man so leicht nicht aus dem Ohr bekommt. Kurz: Ein Filmgenre das es dem einfachen Deutschen/Österreicher erlaubte wieder Stolz auf sich und sein Land zu sein. Und genau da lag in den Augen vieler das Problem!
Man kann argumentieren, dass die Musik aus Amerika nicht nur ihrer beschwingten Natur wegen so gut ankam, sondern auch weil sie der ehrlichen Not und dem Lebenshunger der versklavten afroamerikanischen Bevölkerung entstammt, die noch immer in jedem Akkord mitschwingt. Der Nachkriegsschlager hingegen wischt seine Vergangenheit beschämt vom Tisch, eine Vergangenheit in der unschuldige Menschen verfolgt und auf grausamste Art und Weise getötet wurden, und ersetzt sie durch eine rosarote Brille in der eh alle lieb und nett zueinander sind. Obwohl es natürlich Schnittmengen zwischen den Musikstilen gab, war der zunehmende Generationenkonflikt nur eine Frage der Zeit!
Fortsetzung folgt
#FEEDBACK