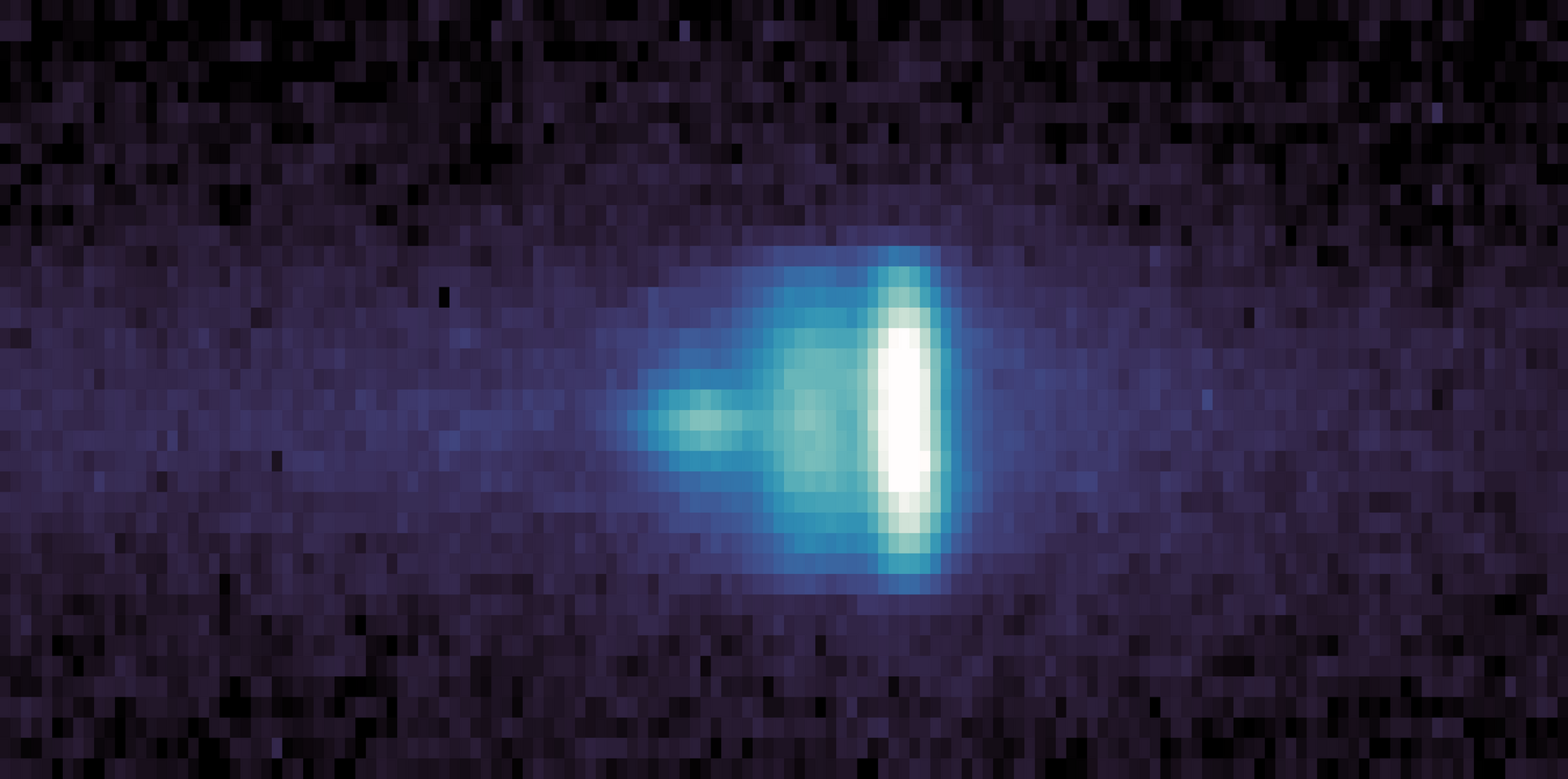DRITTER WELTKRIEG - EINE EINSCHÄTZUNG
DIE ZUKUNFT DER WELT - PROF. DR. HEINZ GÄRTNER
Prof. Dr. Heinz Gärtner ist Politikwissenschaftler und Sicherheitsexperte mit Schwerpunkt internationale Beziehungen. Er lehrt an der Universität Wien und ist Senior Fellow am Österreichischen Institut für Internationale Politik (oiip).
Gärtner beschäftigt sich in seiner Forschung mit Fragen der Neutralität, Sicherheits- und Friedenspolitik sowie den transatlantischen Beziehungen. Er hat zahlreiche Fachpublikationen veröffentlicht, ist regelmäßig als Experte in den Medien präsent und wirkt in internationalen Gremien zur Sicherheits- und Außenpolitik mit.
Das Gefühl kennt inzwischen jede*r: Die Nachrichtenlage ist explosiv, der Ton aggressiv, die Worte schriller. Von allen Seiten ist von Aufrüstung die Rede, von Sicherheitsstrategien, von neuen atomaren Drohkulissen. Und die Angst vor einem Dritten Weltkrieg? Die ist längst salonfähig geworden.
Inmitten dieser brodelnden Weltlage gibt es Stimmen, die nicht mit dem Säbel rasseln, sondern mit klarem Blick analysieren. Eine davon gehört dem Politikwissenschaftler Heinz Gärtner. Sein Appell: Nicht mitmarschieren – nachdenken. „Es hat schon einmal eine Welt gegeben, in der niemand einen Krieg wollte – und am Ende alle mittendrin waren“, warnt er.
Gärtner spielt auf das berüchtigte „Hineinschlafwandeln“ in den Ersten Weltkrieg an. Was damals durch nationalistische Kurzsichtigkeit passierte, droht heute durch militärische Rhetorik. „Fast nur noch Militärexpert*innen kommen zu Wort. Friedensforschung? Fehlanzeige.“ Und dann dieser Satz: „Über Nuklearwaffen wird inzwischen geredet, als wären es handelsübliche Raketen.“
Die Welt sei keineswegs multipolar, sagt Gärtner. Vielmehr sei sie schief. Mächte mit Atomwaffen bestimmen den Ton – allen voran die USA, China und mit Abstrichen Russland. Letzteres zwar wirtschaftlich geschwächt, aber noch immer gefährlich. Und Europa? Europa rüstet auf. Schweigt. Und duckt sich weg.
Was Gärtner fehlt, ist politischer Mut. Und Fantasie. Denn statt Diplomatie wiederzubeleben, wie in den 1970er-Jahren bei der Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, dominiert heute martialisches Denken. „Damals sprachen alle von gemeinsamer Sicherheit. Heute spricht man von Gegner*innen, Bedrohungen, Herausforderungen. Das hat System.“
Gärtner fordert eine Rückkehr zum Prinzip der „unteilbaren Sicherheit“. Heißt: Wer sich selbst schützt, muss auch fragen, wie sich andere damit fühlen. „Wenn ich eine Rakete stationiere, muss ich bedenken, ob das jemand anderen provoziert.“
Gerade in Bezug auf die Ukraine sieht er verpasste Chancen. Statt auf diplomatische Ansätze zu setzen, bereite sich Europa auf eine neue Teilung des Kontinents vor. „Ein neuer Eiserner Vorhang, der sich von der Arktis bis ans Schwarze Meer zieht – das ist keine Dystopie, das ist Planungsgrundlage“, warnt er.
Die Parallelen zur Kubakrise 1962 seien offensichtlich. Auch damals wurde die andere Seite nicht mitgedacht. Die Sowjetunion stellte Raketen auf, die USA drohten mit Krieg. Erst in letzter Sekunde wurde abgerüstet. „Wir haben mehrfach nur dank besonnener Militärs keinen Atomkrieg erlebt“, erinnert Gärtner.
Er kritisiert auch das europäische Schweigen angesichts der Aufrüstung Chinas und der Eskalationen rund um Taiwan. Statt eine vermittelnde Rolle einzunehmen, lasse man sich in Lager drücken. „Es gibt eine Umfrage: 60 Prozent der EU-Bürger*innen wollen im Falle eines USA-China-Konflikts neutral bleiben. Warum nicht Regierungen, die das umsetzen?“
Dabei sei Neutralität kein Rückzug, sondern eine Strategie. Ein Spielraum. Ein Signal. „Österreich 1955 war ein Erfolgsmodell“, sagt Gärtner. Und erinnert daran, dass selbst 1907 der britische König dem österreichischen Kaiser Franz Joseph vorgeschlagen hatte, sich neutral zu verhalten. „Hätte er das getan, vielleicht wäre es nie zum Ersten Weltkrieg gekommen.“
Gärtner sieht Europa in einer ähnlichen Rolle wie damals. Und macht deutlich, dass es schon einmal besser war: beim Iran-Atomabkommen 2015 etwa. „Drei europäische Staaten haben das verhandelt. In Wien. Ein Durchbruch. Und dann kam Trump – und Europa war wieder still.“
Statt einer eigenen Außenpolitik gibt es Empörung über Trump, über Putin, über Xi Jinping – aber kaum Initiative. „Trump hat Nordkorea mit dem Atomknopf gedroht, Europa hat zugeschaut. Er hat den Nahost-Friedensplan zerpflückt, Europa hat geschwiegen. Und jetzt wundert man sich über die eigene Bedeutungslosigkeit.“
Für Gärtner ist das größte Versäumnis nicht die militärische Schwäche Europas – sondern die politische. „Es braucht keine Präsidentin für Europa. Es braucht nur jemanden, der Ideen hat. Und den Willen, sie umzusetzen.“
Seine Analyse ist messerscharf, seine Forderung glasklar: Nicht mehr länger die Rolle der Zaungäste spielen, während die Welt aufrüstet. Europa hat Geschichte gemacht – es kann es wieder tun. Wenn es sich endlich traut.
#FEEDBACK

Der Text von "Nóttin talar" (Die Nacht spricht) drückt tiefe Traurigkeit und den Wunsch aus, in die Vergangenheit zurückzukehren. Bilder wie ein versteckter Pfad und ein grauer Spiegel deuten auf eine Innenschau und den Wunsch hin, zur Vergangenheit zurückzukehren. Der Sänger spricht von Erinnerungen, die wie Glut brennen, und unausgesprochenen Worten, und fragt sich, ob Antworten in einer anderen Zeit existieren. Es gibt ein starkes Gefühl der Schuld und den Wunsch, vergangene Fehler ungeschehen zu machen, wobei wiederholt darum gebeten wird, Í GEGNUM TÍMANN (durch die Zeit) zurückzukehren, um Dinge zu reparieren. Das Vergehen der Zeit wird durch fallende Tage und stille Tränen dargestellt, was hervorhebt, dass die Zeit nicht umgekehrt werden kann. Der Sänger träumt von einer zweiten Chance, präsent und liebevoll zu sein. Auch wenn eine Rückkehr unmöglich sein mag und der Schmerz persönlich ist, bleibt die Hoffnung, Dinge richtigzustellen. Das Musikvideo, das drei junge Männer beim Spaß zeigt, steht im Kontrast zu diesen traurigen Texten. Es scheint hervorzuheben, wie schnell die Jugend und diese unbeschwerten Zeiten vergehen und wie Handlungen in der Jugend später zu Bedauern führen können. Die Freude im Video repräsentiert eine Zeit, die nicht zurückgebracht werden kann, und die Texte deuten darauf hin, dass die jungen Männer eines Tages zurückblicken und sich wünschen könnten, sie hätten Dinge anders gemacht. Der Unterschied zwischen den fröhlichen Bildern und den traurigen Worten betont, wie die Zeit vergeht und wie unsere vergangenen Handlungen uns belasten können. Hier gibt es mehr Informationen zum Musikprojekt: https://www.kollektiv-magazin.com/ai-musikprojekt-dominion-protocol
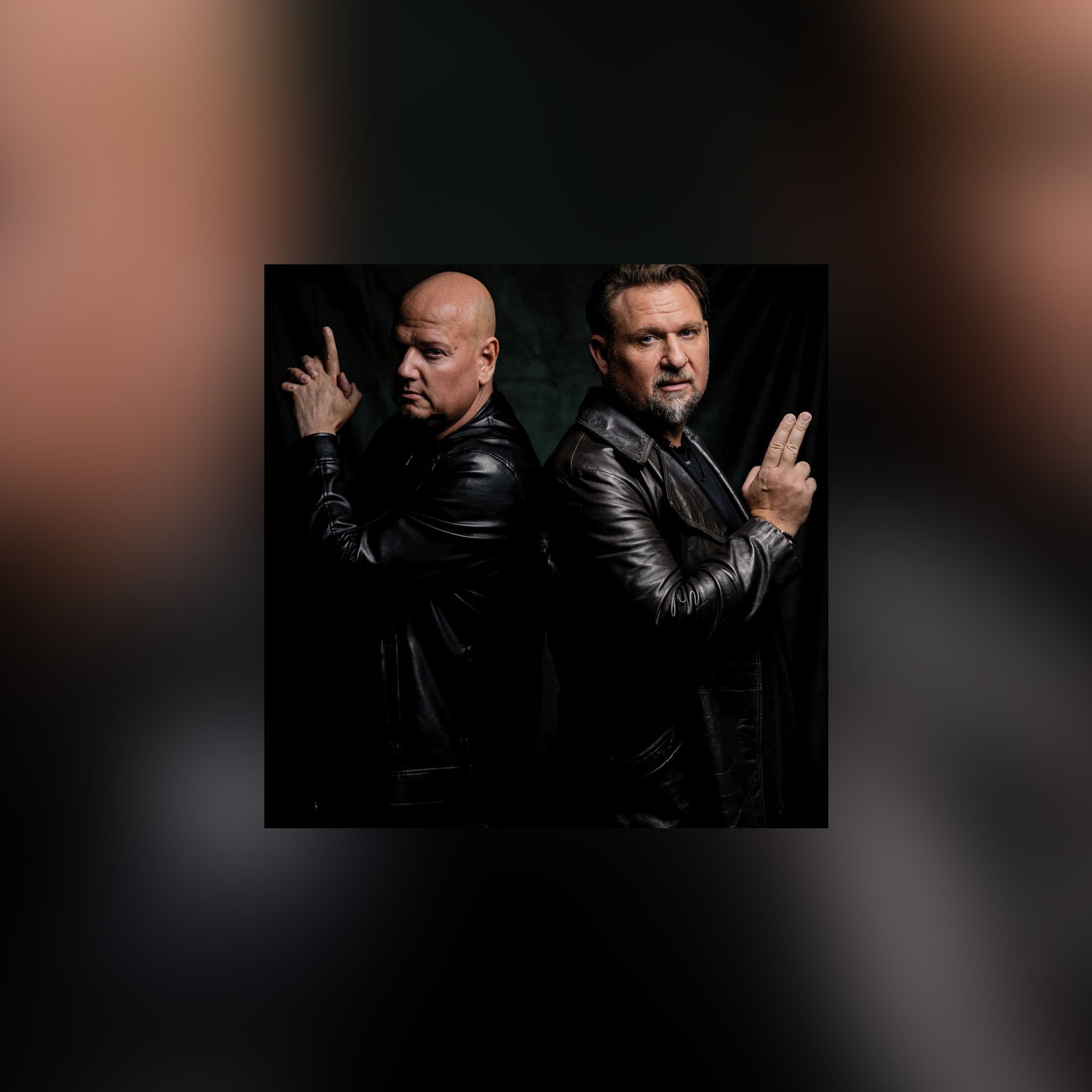
Eigentlich stehen sie in der zweiten Reihe und halten den großen Stars des Landes den Rücken frei. Doch wenn Thommy Pilat und David Pross gemeinsam die Bühne betreten, gehört das Rampenlicht ganz allein ihnen – und ihrem unnachahmlichen Mix aus virtuoser Musik und Wiener Kleinkunst. Wien, 15. Bezirk. Das „Tschocherl“ ist eigentlich ein Ort für die kleinen Momente, doch an diesem Abend wirkt es fast zu klein für die geballte Präsenz, die da auf der Bühne steht. Thommy Pilat und David Pross haben geladen. Wer die beiden kennt, weiß: Hier geht es nicht nur um Noten, hier geht es um das „G’fühl“. Die Edel-Dienstleister treten vor Normalerweise sind die beiden das, was man in der Branche respektvoll „Jobmusiker“ nennt. Hochkarätige Profis, die gebucht werden, wenn der Sound perfekt sitzen muss. Ob als Begleitmusiker für namhafte Austropop-Größen oder in diversen Studioformationen – Pilat und Pross haben in der heimischen Szene längst ihre Spuren hinterlassen. Doch das Duo-Projekt ist ihr Herzstück, ihre kreative Spielwiese. Hier erfüllen sie sich den Traum, die großen Gesten der Popwelt gegen die Intimität der Kleinkunst einzutauschen. Das Ergebnis ist eine Melange aus anspruchsvollem Repertoire und einem Unterhaltungswert, der oft an klassisches Kabarett grenzt. Zwei Originale: Wer sind die Männer hinter den Instrumenten? Thommy Pilat ist in Wien kein Unbekannter. Als Sänger und Gitarrist steht er normalerweise seiner eigenen Formation „Thommy Pilat & Band – Die JÄGER“ vor. Er beherrscht die Kunst, Gefühle in seine Stimme zu legen, ohne dabei ins Kitschige abzugleiten. Im Duo mit Pross übernimmt er den Part des charmanten Erzählers, dessen Gitarrenspiel so präzise wie gefühlvoll ist. David Pross hingegen ist das musikalische Schweizer Taschenmesser des Duos. „Der David kann leider jedes Instrument spielen“, scherzt ein Gast im Video – und trifft damit den Kern. Ob am Bass, am Klavier oder mit seiner markanten Stimme, die jedes Cover zu einem eigenen Song macht: Pross ist ein Vollblutmusiker durch und durch. Seine Vita ist geprägt von der Zusammenarbeit mit zahlreichen Künstlern der Wiener Szene, wobei er oft auch als Produzent und Arrangeur im Hintergrund die Fäden zieht. „Die zwei Bladen“ und der Asterix-Faktor Was den Abend im Tschocherl so besonders macht, ist die Authentizität. Die beiden nehmen sich selbst nicht zu ernst. Mit einer ordentlichen Portion Wiener Schmäh wird über das eigene Gewicht gefrotzelt – ein Insider-Witz, der sogar zu dem (inoffiziellen) Arbeitstitel „Die zwei Bladen“ führte, initiiert von ihren eigenen Partnerinnen. Vergleiche mit Asterix und Obelix oder einem „Brad Pitt in Troja“ (mit einem Augenzwinkern) fliegen durch den Raum. Es ist diese Mischung aus Selbstironie und musikalischer Perfektion, die das Publikum abholt. Man hört Klassiker wie „Ohne Dich schlaf ich heut Nacht nicht ein“ oder „Marlene“, doch in der Interpretation von Pilat & Pross klingen sie nicht nach Kopie, sondern nach einer ehrlichen Hommage. Ein Abend für die Seele Das Fazit der Zuschauer ist eindeutig: „Sensationell“, „authentisch“, „einfach nur geil“. Es ist die Chemie zwischen den beiden „Männern im besten Alter“, wie es ein Fan ausdrückt, die den Funken überspringen lässt. Wenn sie am Ende des Abends „Free Falling“ anstimmen, dann glaubt man ihnen das aufs Wort. Pilat & Pross beweisen, dass man nicht immer die großen Stadien braucht, um große Kunst zu machen. Manchmal reicht ein kleines Lokal im 15. Bezirk, zwei Instrumente und zwei Musiker, die genau wissen, wer sie sind – und was sie können.